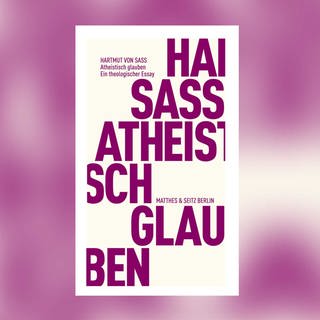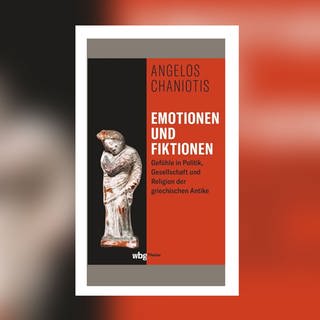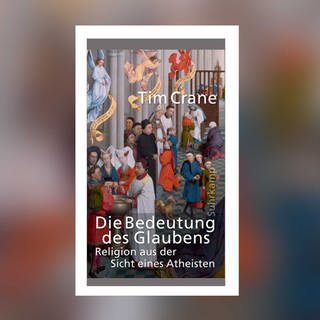Die christlichen Kirchen seien längst nicht mehr Volkskirchen. Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller macht deutlich, dass es im Interesse des Staates, aber genauso auch der Kirchen liegt, ihr Verhältnis zueinander zu klären.
Der säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann
– kaum ein Satz wird so oft zitiert wie dieser, wenn es um das Verhältnis zwischen Staat und Kirche, zwischen Religion und Politik geht. Er stammt von dem ehemaligen Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde und scheint manchen eine Art Freibrief für die privilegierte Stellung der christlichen Kirchen in der Bundesrepublik zu sein – wobei Böckenförde selbst später diesen Satz relativierte:
Er bedeute gerade nicht, dass die Kirchen sich selbstgefällig als eine Art Sinnstifter de luxe ansehen sollten. Dass sie diese Funktion – wenn sie sie denn je hatten – längst verloren haben, ist eine der zentralen Thesen des katholischen Kirchenrechtlers Thomas Schüller, der in seinem jüngsten Buch unter dem Titel Unheilige Allianz unmissverständlich für eine Klärung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat plädiert.
Deutliches Plädoyer für die Klärung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche
Klar sei dieses Verhältnis keineswegs, da es sehr unterschiedliche Interessen der Kirchen gebe, die bei Bedarf kirchlicherseits gerne gegeneinander ausgespielt werden: Die Kirchen verstehen sich als Anwalt der Schwachen, ja, aber sie verfolgen zum Beispiel im Eherecht Interessen ihrer Moralvorstellungen, in Fragen der Staatsleistungen fiskalische Interessen und beispielsweise beim Arbeitsrecht besitzstandswahrende Interessen.
Der Erfolg kirchlicher Interessenvertretung beruht darauf, dass zwischen diesen Feldern hin- und hergesprungen wird und entsprechende „Deals“ abgeschlossen werden
Schüller meint damit, dass der Staat im Wissen darum, auf die Arbeit der großen „Sozialkonzerne“ Caritas und Diakonie angewiesen zu sein, beispielsweise im Arbeitsrecht Zugeständnisse macht, die nur schwer mit dem Grundgesetz und hinsichtlich des katholischen Frauenbildes gar nicht mit den allgemeinen Menschenrechten zu vereinbaren sind.
Formulierungen wie die von den „Sozialkonzernen“ mögen manche Leserin und manchen Leser irritieren – und das ist vermutlich durchaus gewollt: Dabei zeigt Thomas Schüller, dass das in der Bevölkerung im Gegensatz zur Amtskirche angesehene soziale Engagement dieser beiden Institutionen von eben jener Amtskirche genutzt wird, um ihre gesellschaftliche Bedeutung zu unterstreichen und gewisse dunkle Machenschaften in den Hintergrund treten zu lassen.
Gestörtes Verhältnis der Kirche zum säkularen Rechtsstaat
Gemeint ist natürlich der Skandal des sexuellen Missbrauchs – der auch deshalb skandalös ist, weil es immer noch viele Amtsträger gibt, die meinen, es handele sich dabei um ein innerkirchliches Problem, das innerkirchlich zu lösen sei; dies lasse auf ein gestörtes Verhältnis zum säkularen Rechtsstaat schließen: Wer grundrechtsberechtigt sei, müsse auch grundrechtsverpflichtet werden können, stellt Schüller lakonisch fest.
Dabei geht es ihm keinesfalls lediglich darum, einer Trennung nach dem Vorbild des französischen Laizismus das Wort zu reden. Vielmehr liege in der Äquidistanz des Staates zu allen Religionsgemeinschaften auch und gerade für die christlichen Kirchen eine Chance: Statt Betreiber von Sozialkonzernen zu sein, müssten Kirchen zu Identifikationsorten werden, die nur ein Interesse verfolgen sollten: Nämlich das, Anwalt der Schwachen zu sein in einer Gesellschaft, die diesen immer weniger Raum und Stimme lässt.
Eine zunehmend säkulare und religiös diverse Gesellschaft braucht einen Zusammenhalt
Menschen, die – wie Jürgen Habermas es einmal ausgedrückt hat – „religiös unmusikalisch“ sind, werden dieses Buch mit großem Gewinn lesen, denn es versachlicht eine oftmals emotional geführte Debatte.
Aber auch Menschen mit kirchlicher Bindung werden interessante Einsichten bekommen: zum Beispiel diejenige, dass beide Volkskirchen vor der falschen Alternative der – wie Schüller es nennt – Fundamentalismusfalle des verbleibenden heiligen Rests einerseits und andererseits der Relevanzfalle stehen, die dazu führt, sich ständig einer zunehmend säkularen Gesellschaft als unabdingbar anzudienen.
Thomas Schüllers Buch ist ein Appell an die religiös Musikalischen, hier einen dritten Weg zu suchen. Der bestünde in der Tat darin zu zeigen, dass eine zunehmend säkulare und religiös diverse Gesellschaft einen Zusammenhalt braucht, den sie selbst nicht garantieren kann – allerdings braucht sie keine Großorganisationen mehr, die sich vor allem mit sich selbst, das heißt mit ihren Interessen, ihrer Relevanz und ihrem Ansehen beschäftigen.