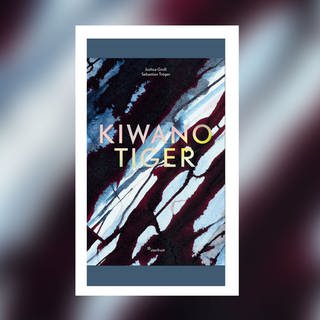Helen ist Künstlerin und besitzt telekinetische Fähigkeiten. In ihrer griechischen Heimatstadt Egio lebt sie zusammen mit ihrem Partner Lenell, der sich mit der Untersuchung der tektonischen Aktivität in der Region beschäftigt.
Das Leben der beiden ist voller Bruchstellen, Surrealem, inneren und äußeren Konflikten sowie Fragen wie: Ist es möglich, nur nach persönlicher Erfüllung zu streben? Und wofür soll man die eigenen Kräfte einsetzen – zumal wenn sie, wie in Helens Fall, sogar telekinetisch sind?
Das Cover muss man ziemlich weit von sich weghalten, um zu erkennen, dass das abstrakte Gebilde darauf das Profilbild einer geologischen Bruchzone ist. Rätselhaft kommt das Buch daher. Dabei scheint auf den ersten Seiten alles noch ganz einfach: Helen ist eine gefragte bildende Künstlerin mit Ausstellungen in ganz Europa.
Sie reist herum, auch in den hohen Norden, ins Permafrostgebiet, wo sie an neuen Bildern arbeitet. Ihr Partner Lenell arbeitet als Seismologe in Egio, Griechenland. Er beschäftigt sich mit der geografischen Bruchzone, an deren Rand Egio liegt. Lenell ist depressiv und braucht Hilfe, was die Beziehung zu Helen stark belastet.
Der Punkt, an dem es zumindest für Helen kompliziert wird, ist ihr Gewissenskonflikt im Umgang mit ihren telekinetischen Fähigkeiten. So kann sie zum Beispiel den durch den Klimawandel aufgetauten Permafrostboden wieder gefrieren lassen.
Kunst oder Weltrettung
Damit verbunden ist für sie die existentielle Frage, ob es nicht besser wäre, ihre Kräfte für die Verbesserung der Welt einzusetzen oder wenigstens Lenells Depression zu heilen, anstatt Kunst zu machen.
War das nicht Verschwendung? Vielleicht wäre es richtig, dachte sie, wenn jeder Mensch in diesem Sinne für den Planeten arbeiten würde, für die Zukunft und für nichts sonst.
Der Roman handelt nicht nur auf der inhaltlichen Ebene von Bruchzonen, auch formal tun sich Brüche auf: Da ist zum einen Groß’ sehr gegenwärtige Sprache: Da pulsieren Wolkenschichten cremig, da wird „geswervt ohne Demut“, da hat Lenell „Speedracerqualitäten“.
Und der Text ist durchzogen von immer wieder auftauchenden und fein verbundenen Motiven, den Koräen-Kiefern, dem Meer oder den titelgebenden Plasma-Augentropfen.
Was im Verlauf der Lektüre jedoch zunehmend stört, sind die sich häufenden Passagen, in denen die Figuren sich selbst reflektieren. Hier verschwindet Groß’ feiner literarischer Ton hinter einer abstrakten und in vielen Fällen aus Theoriefragmenten zusammengesetzten Sprache, die am Anfang lediglich irritiert, im Verlauf des Textes aber ermüdet und dazu führt, dass man blättern oder zumindest diese langatmigen Passagen überspringen möchte.
Und wenn man müde war, gegen die Beschwichtigungen anzukämpfen, konnte man entweder indolent werden oder depressiv. Oder versuchen, im Fernmöglichsten die Misskonfigurationen auszuhalten, sie spürbar zu machen, wobei man sich eben ständig sagen musste, dass es kein Vorgeben war, kein Vorschieben. Und mündete das Aushalten der Misskonfigurationen nicht auch in einer Depression höherer Ordnung?
Außerdem stört im Handlungsverlauf immer mehr der Eindruck der Wohlstandsblase, in der sich die Figuren befinden: Ständig wird guter Espresso aus Siebträgermaschinen getrunken, Müsli mit frischem Obst zubereitet und Basketball gespielt – oder Racinggames am Handy.
Helen schüttete sich den zweiten Espresso rein. Sie verspeiste ein Croissant und steckte das andere in die Gepäckbox. Sie zahlte. Dann fuhr sie mit ziemlich viel Speed nach Osten. Bröckelnder Asphalt oder sogar Schotterstraßen. Diffuse Schilder. Aber ihr Navi war zuverlässig. Im Grunde musste sie sich auf die Helligkeit zubewegen, die am Horizont sengte.
Erfahrungsarmut der Figuren
Wirkliche Arbeit kommt in dem Text schlicht nicht vor. Die künstlerische Tätigkeit Helens erahnen wir nur aus ihren Reflexionen, etwa wenn sie sagt, dass gemalte Bilder sie nicht interessieren, sondern nur diejenigen, die sie in Zukunft noch malen wird.
Und auch die seismologische Arbeit Lenells wird nicht gezeigt, sondern schlicht und ergreifend in kurzen Sätzen behauptet, etwa wenn er am Computer kurz Daten überprüft, nur um sich dann sofort wieder einem YouTube-Meditationsvideo oder seinen verqueren Selbstreflexionen zuzuwenden.
Auch der surreale Spechtmensch, ein Wesen halb Vogel, halb Mensch, mit dem Lenell ein homoerotisches Verhältnis beginnt und sich damit aus der Depression befreit, rettet den Text nicht vor seiner Banalität und der letztendlich überall durchschimmernden Erfahrungsarmut der Figuren.
Hier stellt Groß seine Figuren ein Stück zu sehr bloß, indem er andeutet, die Depression sei womöglich nur eine Folge der Wohlstandsverwahrlosung kinderloser Mittdreißiger. Dieser Bruch zwischen inhaltlicher Oberflächlichkeit und formaler Raffinesse löst sich – anders Lenells Depression – leider nicht auf.
Mehr Literatur von Joshua Groß
Buchkritik Joshua Groß, Sebastian Tröger – Kiwano Tiger
Die Kiwano, auch Zacken- oder Horngurke genannt, ist eine kürbisartige Frucht, die auf unserer Erde in Saharanähe wächst. Im von Tigern bevölkerten Universum von Joshua Groß‘ „Kiwano Tiger“, ist die Frucht der Lieblingssnack der Großkatzen. Und das ist nicht die einzige Eigenartigkeit, die dieses Buch zu bieten hat…
Rezension von Nina Wolf.
Herausgeber: Institut für moderne Kunst, Nürnberg
Starfruit Publications, 88 Seiten, 20 Euro
ISBN 978-3-922895-55-8
Gespräch Joshua Groß - Prana Extrem
Ein sehr heißer Sommer, und alles gerät ins Fließen: Wahrnehmungen, Gefühle, Beziehungen.
Joshua Groß erzählt in diesem autofiktionalen Roman von der Generation der 30jährigen in einer bedrohten Welt. Vom Eintauchen in den Lebensatem „Prana“ und der Sehnsucht nach Verbundenheit.
Ein auch sprachlich eigenwilliger Roman, der sich erzählerisch dem Prinzip des Zufalls hingibt.
Anja Brockert im Gespräch mit Frank Hertweck.
Matthes & Seitz Verlag, 301 Seiten, 24 Euro
ISBN 978-3-7518-0086-0