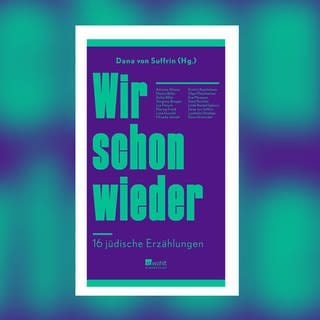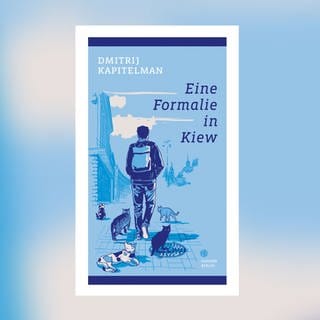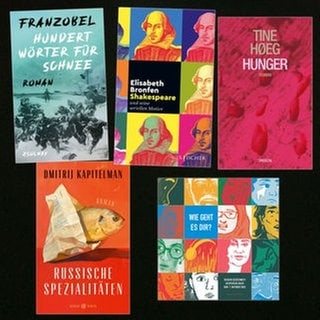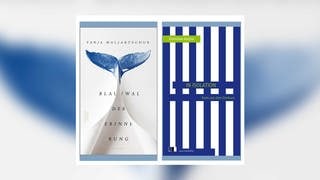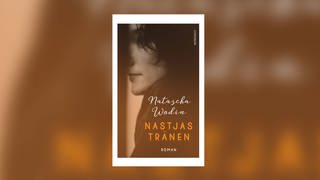„Man darf den Mördern nicht die Sprache überlassen“: Dmitrij Kapitelman über „Russische Spezialitäten"
In seinem neuen Roman verhandelt Dmitrij Kapitelman große politische und auch private Themen: Russlands Krieg gegen die Ukraine, der Rechtsruck in Deutschland und das Festhalten an seiner russischen Muttersprache.
Ein wichtiger Schauplatz: Der „Magasin“, ein Laden für russische Spezialitäten in Leipzig. „Ich nehme mir in diesem Buch Freiheiten, die ich mir noch nie genommen habe", sagt der Autor und Journalist Dmitrij Kapitelman.
Frische sprechende Fische im „Magasin“
In seinem Roman „Russische Spezialitäten“ finden sich allerlei surreale Momente: Menschen verwandeln sich in überdimensionierte Zigaretten, Fische und Maschinengewehre fangen an zu sprechen. Für Kapitelman sei das ein Weg gewesen, um „die Bizarrheit unserer Gegenwart einfangen zu können“. Um näher an die Realität rankommen zu können, habe er ins Fantastische ausweichen müssen.
Parallelen zum Leben des Autors
Die Realität, das ist der „Magasin“, der Laden für russische Spezialitäten in Leipzig, der den Eltern seiner Hauptfigur Dmitrij gehörte. Und diese Realität, das ist auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, das Geburtsland des Erzählers.
Dass sein Held genauso heißt wie er, sei kein Zufall, sagt Dmitrij Kapitelman. Auch er ist in Kyjiw geboren und es gab auch den Laden seiner Eltern in Leipzig:
Aber es ist mir wichtig, dass es ein Roman ist, der viel mehr Perspektiven zeigt als die, die persönlich kenne. Und es ist ein Roman über autoritäre Gewalt und über Wahrheitsfälschung.
Wem gehört die russische Sprache?
Diese Wahrheitsfälschung flimmert im Roman tagtäglich ins Wohnzimmer von Dmitrijs Mutter: Sie schaut russisches Staatsfernsehen und glaubt der Propaganda über die Ukraine und den Krieg. Für Dmitrij ist das schwer auszuhalten.
Seine Mutter und seine Muttersprache fühlen sich für ihn fremd an, gleichzeitig aber möchte er diese Entfremdung nicht zulassen: „Die Liebe zur russischen Sprache wie zur russischen Mutter ist ein zentrales Motiv in diesem Buch. Das ist emotional wichtig und es ist eine politische Emanzipation, denn diesem Regime im Kreml gehört diese Sprache nicht. Es hat sie vor ihnen gegeben und es wird sie nach ihnen geben", so Kapitelman.
Das schwerste Buch über eine schwierige Zeit
Dmitrij Kapitelman ist vergangenes Jahr selbst nach Kyjiw gereist. Die Erfahrungen von dort verarbeitet er im zweiten Teil seines Romans: Luftalarm, Fahrten in die befreiten Orte Butscha und Borodjanka, schwierige Gespräche mit Freunden über die Angst, ins Militär eingezogen zu werden.
Es sei das schwerste Buch gewesen, denn er schreibe über die schwerste Zeit, sagt Kapitelman: „Die Ereignisse, mit denen ich darin ringe, sind so viel blutiger, als ich gedacht hätte, dass sie es je werden"
Mehr Dmitrij Kapitelman
Gespräch Dmitrij Kapitelman über Anthologie „Wir schon wieder. 16 jüdische Erzählungen“
Im Band, den Dana von Suffrin gerade herausgegeben hat, stellt sie sich vor, wie ihre 16 Autorinnen und Autoren in einem Zimmer sitzen und streiten. Einer davon: Dmitrij Kapitelman
SWR2 lesenswert Kritik Dmitrij Kapitelman: Eine Formalie in Kiew
Dmitrij Kapitelman erzählt humorvoll und zärtlich von seinem Versuch in seiner Heimatstadt Kiew ein Deutscher zu werden und sich dabei mit seinen Eltern auszusöhnen.
Hanser Verlag Berlin, 176 Seiten, 20 Euro
ISBN 978-3-446-26937-8
Zeitgenossen Dmitrij Kapitelman: „Ich bin Demokratiedeutscher“.
„Slawisches Mandarin“, so nennt Dmitrij Kapitelman in seinem Roman „Eine Formalie in Kiew“ die ukrainische Sprache. Er ist in Kiew geboren, träumt und spricht auf Russisch und Deutsch. Kapitelmans Geburtsstadt Kiew, die er im Roman als widersprüchliche und pulsierende Metropole beschreibt, ist plötzlich der Ort seiner Alpträume. Er fürchtet er um das Leben seiner Kindheitsfreunde.
Mehr Literatur zum Thema
lesenswert Magazin Sprechende Fische und heimliche Herrscherinnen: Neue Bücher u.a. von Dmitrij Kapitelman, Elisabeth Bronfen und Franzobel
Geister und Shakespeares Motive in „Serie“, Krieg, Familie, Comics zum 7. Oktober, eine Antihelden-Saga und ein verzweifelter Kinderwunsch im lesenswert Magazin.
Gespräch Tanja Maljartschuk: „Heimat ist da, wo deine Traumata sind“
Infolge des russischen Angriffskriegs bezeichnet sich die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk als gebrochene Autorin, die ihr Vertrauen in die Sprache verloren hat.
Gespräch Andrej Kurkow – Tagebuch einer Invasion
Tagebuch schreiben in Zeiten des Krieges – das machen augenblicklich viele ukrainische AutorInnen. „Die Arbeit an meinem neuen Roman ruht“, erzählt Andrej Kurkow, Präsident des ukrainischen PEN, im Gespräch mit SWR2-Literaturredakteurin Katharina Borchardt. Stattdessen schreibt er ein laufendes Tagebuch, das er inzwischen auch zum Teil veröffentlichte. Es heißt: „Tagebuch einer Invasion“.
Reportage Die Literaturszene in der Ukraine
Am 24. August 2021 feierte die Ukraine 30 Jahre Unabhängigkeit. Der junge Staat hat eine aufregende Literaturszene. Besonders ukrainische Autorinnen bekommen hierzulande immer mehr Aufmerksamkeit. Ihre Texte handeln von der wechselvollen Geschichte ihres Landes, aber auch vom aktuellen Krieg.
Reportage von Christiane Seiler.
Stanislaw Assejew - "In Isolation"
edition.fotoTAPETA, 224 Seiten, 15 Euro
ISBN 978-3-940524-94-2
Natalka Sniadanko - Der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde
Aus dem Russischen von Maria Weissenböck
Haymon Verlag, 424 Seiten, 25,90 Euro
ISBN 978-3-7099-3448-7
Tanja Maljartschuk - Blauwal der Erinnerung
Aus dem Russischen von Maria Weissenböck
Kiepenheuer & Witsch Verlag, 288 Seiten, 22 Euro
ISBN 978-3-462-05220-6
Serhij Zhadan - Internat
Suhrkamp Verlag, 300 Seiten, 22 Euro
ISBN 978-3-518-42805-4
Buchkritik Natascha Wodin - Nastjas Tränen
Nastja arbeitet in den 1990er Jahren als Putzfrau in Berlin. In Kiew war sie einst Tiefbauingenieurin, doch damit kann sie ihre Familie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr ernähren. Als Illegale in Berlin verdient sie besser, gerät aber auch in gefährliche Abhängigkeiten. In „Nastjas Tränen“ erzählt Natascha Wodin von Heimatlosigkeit und moderner Leibeigenschaft.
Rezension von Katharina Borchardt.
Rowohlt Verlag, 192 Seiten, 22 Euro
ISBN 978-3498002602