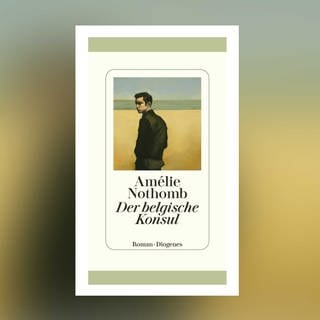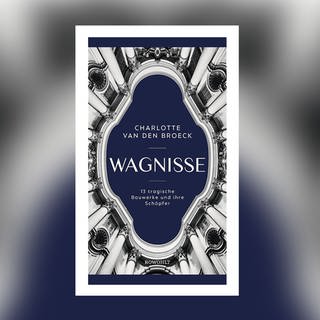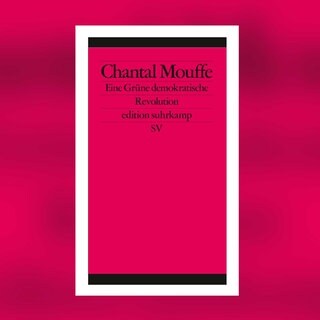Roger Van de Velde – Knisternde Schädel
Bereits die erste Geschichte in Roger Van de Veldes Erzählungsband „Knisternde Schädel“ geht einem unter die Haut. Im großen Aufenthaltsraum einer psychiatrischen Anstalt taucht plötzlich blutverschmiert Jules Leroy auf. Breitbeinig steht er da und hält Puschkin am ausgestreckten Arm hoch. Puschkin ist der von allen Insassen, besonders aber auch von Jules geliebte Kater der Anstalt. Jetzt aber hat ihn Jules gegen die Wand geschlagen und seinen Kopf zertrümmert, weil er ein Stück Grillfleisch aus Jules Henkelmann gestohlen hatte. Die Insassen sind wie gelähmt. Als Jules von einem Wärter aufgefordert wird, den Kadaver in den Garten zu schmeißen, und jemand ihn ‚Dreckskerl‘ nennt, beginnt er, um sich zu schlagen. Fünf Wärtern gelingt es schließlich, ihn - in eine Zwangsjacke geschnürt - wegzubringen.
Geschichten aus dem Irrenhaus
Van de Velde erzählt, wie er selbst schreibt, Geschichten aus einem „Irrenhaus“. Nicht alle zeigen so drastisch die plötzlich ausbrechende Unbeherrschtheit einiger Patienten oder die latente Gefahr, die von ihnen ausgeht. Auch Evarist hält sich zum Glück zurück, als er dem Erzähler den Bart abrasiert, wobei er ihm mit dem scharfen Messer ebenso gut die Kehle durchschneiden könnte. Denn Evarist gilt als potentiell aggressiv, weil er seinen Sexualtrieb nicht ausleben kann. Alle Insassen leiden an einem Verlust der Selbstbestimmung, an Einsamkeitsgefühlen oder eben auch unter dem Diktat der Betäubungsmittel, die ihnen zur Ruhigstellung verabreicht werden.
Roger Van de Velde kam selbst in eine psychiatrische Anstalt
Das betrifft vor allem auch den Autor Roger Van de Velde selbst. 1925 im belgischen Boon geboren, war er zuerst als Journalist tätig. Nach mehreren Magenoperationen wurde ihm das starke Schmerzmittel Palfium verabreicht, ein Vorläufer des heutigen Fentanyl. Entgegen den Angaben des Herstellers macht es süchtig. Unter Einfluss des synthetisch hergestellten Opioids kommt Van de Velde in Konflikt mit dem Gesetz, wird wiederholt inhaftiert und mit 37 Jahren zum ersten Mal in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Man attestiert ihm eine schwere Geistesgestörtheit. Seine Erzählungen beweisen allerdings das krasse Gegenteil. In allen Geschichten ist der Ich-Erzähler mit großer Aufmerksamkeit anwesend, manchmal nur beobachtend, oft aber auch im Gespräch mit seinen Leidensgenossen. Es ist bewundernswert, mit welch teils humorvoller Empathie er sie darstellt, ohne sich jemals über ihre Absonderlichkeiten lustig zu machen.
Von der Anstaltsleitung als eine Art Schreiber bestellt, lässt er sich zum Beispiel von einem, der von allen nach dem französischen Schriftsteller nur Lamartine genannt wird, „hunderte Briefe mit den kuriosesten und haarsträubendsten Inhalten“ diktieren, adressiert an Würdenträger im In- und Ausland. Oder er lässt sich von einem Neuzugang zum Schachspiel überreden. Bald muss er feststellen, dass der junge Mann nach völlig willkürlichen Regeln spielt und ihn schließlich mit dem Schachbrett bedroht, bevor ihn ein epileptischer Anfall gewissermaßen schachmatt setzt.
Ich traue Dichtern mehr zu als Ärzten
Diese unmittelbare Nähe zu den uns absurd erscheinenden Episoden und Figuren verhindert, dass wir Van de Veldes Erzählungen als phantastische Geschichten lesen. Keine gerät ins Anekdotische. Das bedrohlich Skurrile, das er szenenhaft schildert, bleibt für uns normalerweise verborgen hinter Anstaltsmauern. Van de Velde fand dort keine Heilung. Er starb 1970 mit 45 Jahren, so heißt es, an einer Überdosis Palfium auf einer Bank vor dem Antwerpener Bahnhof. Dank der Übersetzerin Annette Wunschel, die auch ein informatives Nachwort verfasste, können wir nun ein halbes Jahrhundert später Roger Van de Veldes beeindruckende Geschichten zum ersten Mal auf Deutsch lesen. Immer tritt er darin als Zeuge auf, nie als Urteilender. Nur einmal beklagt er in der Erzählung „Margaritas Ante Porcos“ die unmenschlichen Zustände in der Anstalt. Sein Fazit ist ein Lob der Literatur: „Wenn es darauf ankommt, die Beweggründe der menschlichen Psyche auszuloten“, schreibt er, „traue ich Dichtern wesentlich mehr zu als Ärzten.“