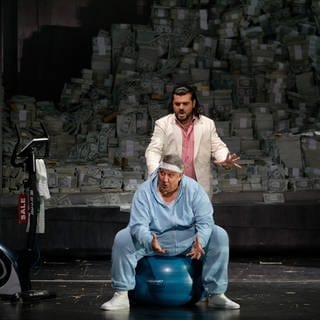Zum Abschluss ihrer künstlerischen Leitung von 2016 bis 2024 der Münchner Biennale haben die beiden Komponisten Daniel Ott und Manos Tsangaris einen Bildband herausgeben. „Schnee von morgen“ ist eine Sammlung von Statements zum Musiktheater der Zukunft in Texten, Gesprächen und poetologischen Reflexionen.
Ist die Oper Schnee von gestern?
„Schnee von morgen“ meint wohl, dass es da auch einen Schnee von gestern geben müsse. Was könnte er sein, dieser Schnee von gestern? Einige der Statementgeber des gleichnamigen Bandes der Münchener Biennale haben es sich einfach gemacht: Es ist wohl die Oper.
Jede Oper ist zwar Musiktheater, aber nicht jedes Musiktheater eine Oper. Und Oper ist sowohl eine musikalische Form, als auch eine Institution. Beide sind uralt. Also: „Schnee von gestern“, mit all seinen unreinen Schmutzflecken und Problemen des Wegschmelzens.
Die Zukunft gehört der Inklusion
Das hört sich dann in den Worten des Professors für Theaterwissenschaft David Roesner wie folgt an: „Dabei geht es mir nicht darum, die ‚alte‘ Oper abzuschaffen oder zu verdammen“. Aber: „Oper in Deutschland schließt – sicher oft ohne es zu wollen – viele Menschen aus.“ Also muss es laut Roesner darum gehen, das Musiktheater der Zukunft inklusiver und immersiver zu machen.
Auf diese Idee sind bereits schon einige Opernhäuser in Deutschland gekommen, allerdings auch ohne die Impulsgabe der Münchener Biennale.
Partituren als „antastbares Material“
Die Roesnersche-Rezeptur, die scheinbar „unantastbare Partitur“ als „antastbares Material“ zu betrachten und die Unterscheidung von „E“ und „U“ abzuschütteln, praktizieren auch schon länger im Musiktheater Inszenierende wie Christoph Marthaler oder musikalisch Leitende und auch programmplanende Intendantinnen und Intendanten.
Kurios ist das Statement des Musikwissenschaftlers Jörn Peter Hiekel, wonach im Opernbereich ein nahezu „selbstverständlicher Verzicht auf Aktualisierungen, die auch die Stücksubstanz tangieren“ bestehe.
Warum regt sich dennoch mit schöner Regelmäßigkeit ein bestimmter, konservativ gesinnter Besucherkreis auf, der Oper gerne sehen und hören würde, wie sie einst komponiert wurde? Ihnen ist gerade die Aktualisierung des Vergangenen zumeist des Guten Zuviel. Da fragt man sich dann doch, ob dem Autor die Praxis des sogenannten Regietheaters entgangen sein könnte.
„Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit“
Aber das ist nun wahrlich Schnee von gestern wie auch die Empfehlung, sich für ein Musiktheater der Zukunft beim auch aus Sicht des Komponisten Nono gescheiterten Totaltheaters oder dem sechzig Jahre zurückliegenden Pluralismus von Zimmermanns Oper „Die Soldaten“ zu orientieren.
Es ist folgerichtig, wenn Alexander Kluge, der bekanntlich die Oper als Medium und Institution zum „Kraftwerk der Gefühle“ deklariert hat, sich in der Zukunft des Musiktheaters ausgerechnet bei Léhar, in Verdis „Otello“ oder Webers „Freischütz“ pudelwohl fühlt. Das nennt man dann – um einen anderen legendären Filmtitel Kluges zu zitieren – den „Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit“.
Publikum durch Raumwechsel aktivieren
Jetzt aber zum klassen- und generationsspezifischen, wenngleich unfreiwilligen Ausschlusskriterium der Institution Oper, die ja in der Regel eine Guckkastensituation ist. Zukunftsfähige Inklusion, so die Meinung der künstlerischen Leitung, aber auch der meisten Beteiligten der Münchener Biennale, scheint erst durch flexiblen Raumwechsel möglich. Damit soll auch das Publikum aktiviert werden.
Für Komponst*innen wie Eloain Lovis Hübner und Mart*in Schüttler oder den Autor Thomas Köck heißt die Lösung für die Utopie des – wie Hübner es nennt – politisch-ethisch „guten Musiktheater“ die immersive Rauminstallation. Und da geht es interdisziplinär und genreübergreifend auch in Bereiche der bildenden Kunst, Installation und Performance über.
Beschäftigung mit Musiktheater kein überflüssiger Luxus
Komponiertes Musiktheater ist nicht die Hauptsache. Damit wären dann auch Traditions- und Vergangenheitsorientierung der alten Tante Oper erlöst, wie Mart*in Schüttler meint: „In einer Gegenwart voller Krisen und Konflikte über Zukunft zu schreiben, fühlt sich bedrückend an. Bei diesen Aussichten erscheint die Beschäftigung mit Möglichkeiten des Musiktheaters wie ein überflüssiger Luxus. Jedoch nur, solange man Oper und Musiktheater als Orte der Repräsentation jener Vergangenheit begreift, die den bedrohlichen Zustand unserer Gegenwart verursacht hat.“
Auch nach Meinung der nächsten Generation von Studierenden geht es um ein Komponieren mit Räumen, die sich dann auch mit dem „Klimawandel, Rassismus, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit, Tierquälerei und Missbrauch der Natur“ befassen sollten.
Und damit diese Zukunft Musiktheater nicht monomanisch dem klassisch individualistischen Kunstwerksbegriff anheimfällt, ist sowohl Intertextualität als auch Ko-Autor*innenschaft angesagt.
Musiktheater mit politisch-gesellschaftlicher Relevanz?
Unbeantwortet bleibt die Frage, ob derartig politische Inhaltsstellungen im Musiktheater der Zukunft tatsächlich die Relevanz besitzen, die sie in der Gegenwart der Biennale von 2022 noch hatten, auf die sich die Studierenden hauptsächlich beziehen.
Das im „Schnee von morgen“ beschworene Musiktheater der Zukunft einer politisch-gesellschaflichen Relevanz könnte dann doch auch zum „Schnee von gestern“ werden.
Eine Frage lässt der Statementband allerdings offen: Wie sie denn nun klingen könnte, diese Zukunft des Musiktheaters. Sie ist jedenfalls lebendig, denn sie atmet, wie die Komponistin Chaya Czernowin in ihren poetischen Überlegungen schreibt: „It‘s a black box theater but it’s breathing.“
Mehr zur Zukunft des Musiktheaters
Glosse Komponist Gordon Kampe: Regietheater hält in Schwung!
Wie oft wird geächzt und gestöhnt übers „Regietheater“. Über angeblich böse Regisseure, die mutwillig an unseren Opernklassikern kratzen, um sie für ihre Zwecke zuzurichten. Aber kann man das nicht auch mal entspannter sehen? Komponist und SWR2-Glossator Gordon Kampe betrachtet den Dauer-Aufreger aus seiner Sicht und meint: Regietheater ist Teamsport und hält in Schwung!
Editionsprojekt „Critical Classics“ Rassismuskritische Textänderungen in der Oper: Eine Neu-Edition der „Zauberflöte“
Das Editionsprojekt „Critical Classics“ gibt Anlass zur Frage, ob es auch bei Opernklassikern rassismuskritische Textänderungen geben wird, wie etwa bei Kinderbuchklassikern. Berthold Schneider, Regisseur und langjähriger Opernintendant der Wuppertaler Bühnen, hat jetzt eine Reihe ins Leben gerufen, in der er alternative Textvorschläge für Opernklassiker macht. Den Anfang macht eine Neufassung der „Zauberflöte“.
Gespräch „Grundmusikalisierung“ aufrechterhalten: Axel Köhler ist neuer Rektor an der Stuttgarter Musikhochschule
Novum an der Stuttgarter Musikhochschule: Ein Countertenor wird Rektor. Axel Köhler war bereits Intendant der Oper Halle und führte bei über 50 Opern und Operetten Regie. Am 1. Dezember 2023 hat er sein neues Amt angetreten.