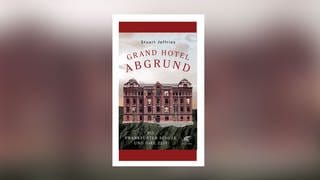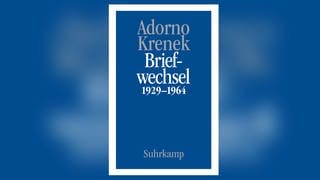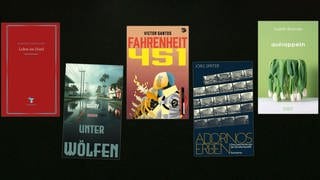Als 1951 das Institut für Sozialforschung an der Frankfurter Universität wiedereröffnet wurde, konnte niemand ahnen, wie wichtig dieser Schritt für die junge Bundesrepublik war. Unter Max Horkheimer und Theodor W. Adorno wurde das Institut zu einer moralischen Instanz. Der Historiker Jörg Später erzählt die lange Geschichte der Frankfurter Schule von den Anfängen in den 1920er Jahren bis heute.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die deutsche Bevölkerung nicht nur mit dem unvorstellbaren Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen konfrontiert, sondern auch an einem moralischen Tiefpunkt angelangt. Wer nicht mit dem Verschweigen und Vertuschen der eigenen Taten beschäftigt war, beteiligte sich an der Verdrängung der Taten anderer. Ein Interesse an einer echten Aufarbeitung der grausamen Vergangenheit hatten nur wenige.
Die Rettung aus dem Exil
In dieser Situation waren es die exilierten Intellektuellen, die der Bundesrepublik zu einem neuen Gewissen verhalfen. Unter denen, die rechtzeitig fliehen konnten, waren viele Juden, die sich immer noch ihrer Heimat verbunden fühlten. Ihre Rückkehr nach Deutschland wurde keineswegs begrüßt, stellten sie doch eine kritische Stimme dar, die niemand hören wollte. Der berühmteste unter ihnen war Theodor W. Adorno, ein öffentlicher Intellektueller wie kaum ein anderer.
Die weitreichenden Folgen dieser Rückkehr hat der Historiker Jörg Später nun in seinem Buch „Adornos Erben. Eine Geschichte aus der Bundesrepublik“ rekonstruiert. Adorno ist erst spät nach der Machtergreifung zunächst nach England, dann endgültig in die USA emigriert. Bei seiner Rückkehr hatte er eine Kritische Theorie im Gepäck, deren Wirkung der Philosoph Manfred Frank wie ein Lebenselixier beschrieben hat:
Meiner ganzen Generation war die Existenz der Kritischen Theorie eine geistige Überlebensfrage angesichts von Eltern und Lehrern, die vom Nationalsozialismus entweder kompromittiert waren oder in einer Vermeidungsstrategie die verspäteten Analysen umgingen.
Der neue kategorische Imperativ
Bereits in seinem amerikanischen Exil hatte sich Adorno einen Namen gemacht, vor allem mit der „Dialektik der Aufklärung“, die er zusammen mit Max Horkheimer geschrieben hatte. Dieses Buch wurde zu einer der wichtigsten intellektuellen Ressourcen der Bundesrepublik und hat ganze Generationen geprägt. Während viele Deutsche die nationalsozialistische Herrschaft am liebsten aus ihrer Erinnerung getilgt hätten, machte Adorno sie zum Ausgangspunkt seines Denkens und formulierte einen neuen kategorischen Imperativ für die Nachkriegszeit:
Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen: ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe.
Für die Verbreitung dieses Imperativs spielte das Institut für Sozialforschung eine zentrale Rolle. Ohne diese Einrichtung an der Frankfurter Universität wäre die enorme Wirkung der Kritischen Theorie nicht möglich gewesen. Gegründet wurde das Institut 1924, seine Gründer waren enttäuscht von der Novemberrevolution. Ihre Absicht war es, eine Theorie der Gesellschaft zu entwickeln, mit der die Klassenkämpfe der Weimarer Republik besser zu verstehen waren als mit der orthodoxen marxistischen Lehre.
Die Auseinandersetzungen von 1968
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde das Institut geschlossen. Die Belegschaft übersiedelte nach New York, wo ihr von der Columbia University ein Haus zur Neugründung überlassen wurde. Wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte das Institut auf Bitten der Stadt Frankfurt wieder zurück und wurde schnell zu einem der wichtigsten Orte für die Aufarbeitung der Vergangenheit.
Nachdem sich Horkheimer zurückgezogen hatte, wurde Adorno alleiniger Direktor des Instituts. Der Höhepunkt seiner Anerkennung als moralische Instanz fiel zusammen mit den Turbulenzen, in die das Institut durch die Studentenbewegung geriet. Dem philosophischen Meister wurde vorgeworfen, einer echten Revolution auszuweichen. Entsetzt musste Adorno zusehen, wie die Studenten unter Berufung auf seine eigene Theorie immer dogmatischer wurden:
In Wahrheit habe nicht ich meine Position geändert, sondern jene die ihre, oder vielmehr die meine, da sie ja doch unendlich viele Kategorien von mir, besser: von der Frankfurter Schule überhaupt bezogen haben. So war’s nicht gemeint.
Als Adorno 1969 starb, hinterließ er ein weit verzweigtes Netz von treuen Anhängern. Sein wichtigster Schüler Jürgen Habermas begleitet die Bundesrepublik bis heute. In seiner brillant geschriebenen Studie geht Jörg Später diesem Netz mit großer Genauigkeit nach. Vor allem aber macht er deutlich, wie wichtig die jüdische Erfahrung für die Begründer der Kritischen Theorie war, ein Umstand, der heute viele Jahrzehnte später selbst an den deutschen Universitäten in Vergessenheit zu geraten droht.
Mehr zur Frankfurter Schule
Diskussion 100 Jahre Institut für Sozialforschung – Wie lehrreich war die Frankfurter Schule?
Auf einer Karikatur von 1968 heißen Sie „Die Marx Brothers“: Adorno, Horkheimer und Habermas sind die Poster-Boys der „Frankfurter Schule“ in der Bonner Republik. Sie entfalteten eine neomarxistische, kritische Gesellschaftstheorie. Angefangen hat das schon Ende Januar 1923. Neuartig war ihre Verbindung von philosophischer Theorie, empirischer Sozialforschung und literarischem Stil. Was eint sie über 100 Jahre hinweg? Lebt der Gründungsgedanke der Herrschaftskritik und Utopie weiter? Gibt es „kein richtiges Leben im falschen“? Michael Köhler diskutiert mit Dr. Svenja Flasspöhler - Chefredakteurin Philosophie Magazin, Berlin, Prof. Dr. Martin Saar - Sozialphilosoph, Goethe-Universität Frankfurt a.M., Dr. Jörg Später - Historiker, Freiburg
Buchkritik Stuart Jeffries - Grand Hotel Abgrund. Die Frankfurter Schule und ihre Zeit.
Stuart Jeffries erzählt die Geschichte der Frankfurter Schule und ihrer Vertreter und geht dabei genau auf deren philosophischen Denkstrategien ein. Das ergibt eine flüssig geschriebene, durchaus kritische und äußerst informative Lektüre. Rezension von Andreas Puff-Trojan. Aus dem Englischen von Susanne Held Klett-Cotta Verlag ISBN 978-3-608-96431-8 510 Seiten 28 Euro
Mehr zu Theodor W. Adorno
Musikmarkt: Buch-Tipp Der Briefwechsel zwischen Ernst Krenek und Theodor W. Adorno
Im Juni 1923 wird in Kassel die Zweite Symphonie des erst 22-jährigen Komponisten Ernst Krenek uraufgeführt. Im Publikum sitzt ein 19-jähriger Philosoph mit ausgeprägten musikalischen Interessen. Er erlebt diese Aufführung als Schock: Theodor W. Adorno. Ein Jahr später lernen die beiden sich in Frankfurt persönlich kennen und beginnen bald darauf einen Briefwechsel, der jetzt in einer Neuauflage vorliegt. Christoph Vratz hat ihn für SWR2 Treffpunkt Klassik gelesen.
SWR2 lesenswert Kritik Theodor W. Adorno: Aspekte des neuen Rechtsradikalismus
Nicht nur Kleinbürger, sondern alle Schichten sind für einen neuen Faschismus anfällig - nicht nur in wirtschaftlichen Krisenzeiten. Weil Nationalismus keine gesellschaftlichen Lösungen bieten kann, ist seine Radikalisierung immanent.
Suhrkamp Verlag
ISBN 978-3-518-58737-9
10 Euro