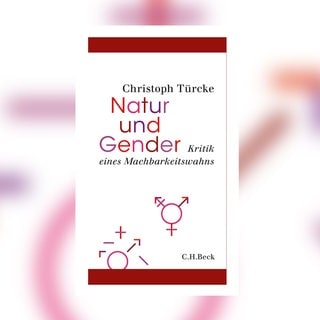Biologische Erkenntnisse gegen Homo- und Transphobie
Als Forscher vor mehr als 100 Jahren entdeckten, dass es auch im Tierreich Homosexualität gibt, sprachen sie von „verderbtem Betragen“ bei den Tieren, aber das nur privat. Frans de Waal schreibt: „Es gab eine Zeit, da es der Wissenschaft nicht gestattet war, homosexuelles Verhalten bei Tieren überhaupt nur zu erwähnen.“
Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, ist der Blick vielerorts immer noch ideologisch statt naturwissenschaftlich bestimmt. Neuerdings gilt das manchen sogar als fortschrittlich, wenn biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern negiert werden, um ihre Gleichstellung zu befördern.
Aber biologische Erkenntnisse haben durchaus auch das Zeug dazu, Homophobie und Transphobie als unberechtigte Ängste zu entlarven, weil es Homo-, Bi- und Transsexualität auch im Tierreich gibt, insbesondere bei den Primaten, die am engsten mit uns verwandt sind, bei Schimpansen und Bonobos.
Zärtlichkeiten sorgen bei Menschenaffen für Entspannung
Schimpansen und Bonobos unterscheiden sich in ihren sozialen Strukturen so deutlich, dass wir sowohl für die Vorherrschaft von aggressiven Männern (bei den Schimpansen) als auch für weibliche Dominanz (bei den Bonobos) Beispiele haben. Bei Letzteren machen auch Männchen mit Männchen Liebe und Weibchen auch mit Weibchen. Großzügig werden allseits Zärtlichkeiten ausgetauscht. Dadurch sind diese Menschenaffen so friedfertig und entspannt wie keine andere Primatenart, weiß Frans de Waal.
Der Primatologe transportiert wissenschaftliche Fragestellungen und Erkenntnisse, die Bedeutung bis tief in unser Liebes- und Familienleben haben, denn, so postuliert er: „sozio-emotional sind wir Primaten durch und durch“. Spannend sei es, die Spielräume auszuloten, die uns als Individuen und in unseren Gesellschaften gegeben sind. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen stereotypem und archetypischem Verhalten.

Auch Schimpansenmädchen spielen gerne mit Puppen
Eine Schlussfolgerung de Waals ist für Eltern und Pädagogen wichtig: „Es ist an der Zeit aufzuhören“, schreibt er, „die Begeisterung, die Mädchen für Babys und Puppen an den Tag legen, als stereotyp zu bezeichnen. Ein Verhalten, das nicht nur weltweit bei Menschen, sondern auch bei vielen anderen Säugern verbreitet ist, lässt sich nicht durch menschliche Vorurteile oder gendertypische Erwartungen erklären.“
Mit anderen Worten, Schimpansenmädchen bereiten sich auf ihre später wahrscheinliche Mutterschaft ganz ähnlich vor wie Menschenmädchen. Sie schleppen Gegenstände mit sich herum, die die gleiche Funktion haben wie Puppen. Aber auch Männer können fürsorgliche Väter werden, wenn die Mutter ausfällt oder wenn sie es wollen, wie inzwischen zahlreiche Menschenmänner.
Vieles können wir lernen, aber nicht unsere Geschlechtsidentität
Aber unsere Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung können wir nicht wählen, schreibt Frans de Waal, es sei nachgewiesen, dass sie genetisch, neurologisch und/oder hormonell bedingt sind und „somit ein unabänderlicher Teil unseres Wesens.“
Die wichtigste Besonderheit menschlicher Gemeinschaften sieht de Waal in unserer „Familienstruktur, die Männer und Frauen fest aneinander bindet“. Das habe zu stärkeren und problematischen Abhängigkeiten geführt. Unsere Biologie sei dabei nicht das Problem, sondern, so formuliert de Waal, die den verschiedenen Geschlechtern „entgegengebrachten Vorurteile, die Ungleichheit, mit der sie behandelt werden, sowie die Beschränkung des traditionellen Zwei-Geschlechter-Modells, das manche Menschen außen vorlässt.“
Frans de Waal kann auch ziemlich komplizierte Zusammenhänge gut verständlich erklären. Dabei ist er ein humorvoller, ein unterhaltsamer Erzähler. Sein fast 500 Seiten dickes Buch zu lesen, ist daher ein überaus anregendes und lehrreiches Vergnügen.