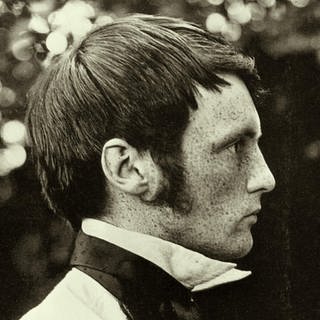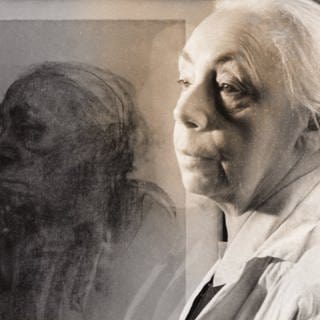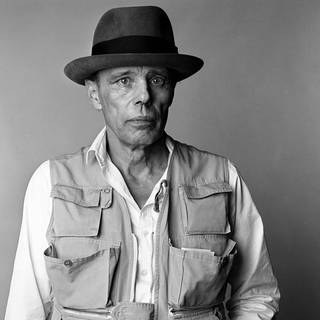Die Werke des Künstlers Eugène Henri Paul Gauguin (* 7. Juni 1848; † 8. Mai 1903) sind weltberühmt. Seine Bilder kosten heute teils Hunderte Millionen Euro, ihre Farbenpracht verzaubert Menschen rund um den Globus, sie schmücken Wandkalender und Museumswände.
Doch wie begegnet man einem der bedeutendsten Maler des 19. Jahrhunderts mit den Maßstäben unserer Zeit? Denn seine Motive vertragen sich nicht mit einem aufgeklärten Verständnis von Exotik, Kolonialismus, Missbrauch Minderjähriger und kultureller Aneignung.
Paul Gauguin flieht vor der Moderne in die Traumwelt der Südsee
Die 1890er waren die späte Phase der Industrialisierung. Frauen hatten kaum Rechte. "Der Mann schuldet seiner Frau Schutz, die Frau ihrem Manne Gehorsam", hieß es in Artikel 213 des Code Napoleon. Mädchen durften von ihren Eltern ab dem 13. Lebensjahr verheiratet werden, Ehefrauen konnten ohne Genehmigung ihres Mannes nicht arbeiten, über eigenes Geld verfügen oder ihren Wohnsitz wählen.
In den europäischen Städten beschleunigten Dampfmaschinen und Elektrizität das Arbeitsleben. Textilfabriken, Eisen- und Stahlwerke waren die führenden Industriezweige. Die Städte wurden laut, dreckig und immer größer. Davor flüchtete der Künstler Paul Gauguin – aus der Moderne aufs Land und in eine Traumwelt. In der Südsee hoffte er sie zu finden. Eine Vision von Menschen, die vermeintlich nur die Süße des Lebens kennen, von Frauen, die sanft und wild zugleich sind. Und so malte er sie: ursprünglich und unzivilisiert, mit leuchtend bunten Farbkompositionen.
Bougainville inspiriert Gauguins exotisches Reiseziel
Den Hinweis auf Tahiti hatte Gauguin dem Reisebericht des Seefahrers Louis-Antoine de Bougainville entnommen, der im April 1768 nach neuntägigem Aufenthalt jene "Liebesinsel Kythera" dem französischen König Ludwig XV. als Kolonie empfahl. Für den wurzellosen, sehnsüchtigen und stets suchenden Künstler ein Erweckungserlebnis.
Jean-Jacques Rousseau und die "edlen Wilden"
Jean-Jacques Rousseau, der französische Aufklärer, sprach schon im 18. Jahrhundert von "edlen Wilden", die im Einklang mit der Natur leben würden – in Frieden und Freiheit, Unschuld und Idylle, in einer Gesellschaft ohne Verbrechen, sexuell freizügig, gesund und glücklich.
Noa Noa: Realität und Fiktion verschwimmen
Gauguin verinnerlichte diese eurozentrische und paternalistische Sicht auf andere Kulturen. Als er Europa in Richtung Südsee verließ, hatte er die koloniale Vision von Exotik und Erotik im Gepäck. Sie findet sich auch in seiner Künstlererzählung Noa Noa wieder. Auch hier verschwimmen Realität und Fiktion.
Zwischen den Steinen versteckt, kauerten hier und dort Frauen mit bis zum Gürtel aufgenommenen Röcken im Wasser, um ihre Hüften und die vom Marsch und von der Hitze ermüdeten Beine zu erfrischen. So gereinigt, machten sie sich, stolz den Busen tragend, über dem der dünne Musselin sich straffte, mit der Grazie und Elastizität junger gesunder Tiere wieder auf den Weg nach Papeete. Ein gemischtes, halb animalisches, halb pflanzliches Parfüm strömte von ihnen aus.
"Noa Noa", zu Deutsch “Der Wohlgeruch” ist ein angeblicher Reisebericht, den Gauguin während und nach seinem ersten Aufenthalt auf Tahiti geschrieben hat. Er sollte die Verkäufe seiner Bilder in Paris begleiten, unterfüttern und vor allem ankurbeln. In seinen vermeintlichen Erfahrungen und Eindrücken inszeniert sich Gauguin als kultureller Überläufer, der im Bruch mit der europäischen Kultur ein einfaches Leben auf einer Pazifikinsel führt. Eine anti-koloniale Emanzipationsbewegung. Das Leben eines echten Wilden, wie er schrieb. Eines, welches er seines Erachtens auch nach und nach selbst annahm. Bis heute streitet die Kunstwissenschaft, ob er wirklich daran glaubte.
Bretagne, Martinique, Tahiti: Gauguin auf der Suche nach dem einfachen Leben
Schon Jahre vor dem Südseeaufenthalt hatte Gauguin die Unversehrtheit und Primitivität des einfachen bäuerlichen Lebens gesucht – bei längeren Aufenthalten in der Bretagne und im französischen Übersee-Departement Martinique in der Karibik.
Er hat sich auch dort als Außenseiter und als Wilder gekennzeichnet. Das hat er übertragen, beziehungsweise war das eine seiner Idealvorstellungen, dass man auch auf Tahiti so leben konnte, wie er sich das gedacht hat: sehr frei, sehr freizügig, auch im sexuellen. Dass er keine großen Bindungen hat, er dort sehr junge Mädchen als Frauen bezeichnet, mit denen er teilweise zusammenlebte, mit denen er Kinder hatte.

Nachdem er seine Frau Mette mit fünf Kindern in Europa sitzen gelassen hatte, setzte Gauguin alle Hebel in Bewegung, um seine sexuellen Fantasien auszuleben. In der Südsee lebte er mit Mädchen zusammen, 13 oder 14 Jahre alt. Obwohl sie selbst noch Kinder waren, wurden sie die Mütter seiner weiteren Kinder. Gauguins Vorstellung der edlen Wilden blickte auf die Tahitianerinnen als sexuell verfügbare Wesen.
Alle haben den geheimen Wunsch nach Vergewaltigung: weil durch diesen Akt männlicher Autorität der Weibwille seine volle Unverantwortlichkeit behält – denn so hat er ja nicht seine Einwilligung zum Beginn einer dauernden Liebe gegeben. Möglich, dass dieser erst so empörenden Gewalt ein tiefer Sinn zugrunde liegt, möglich auch, dass sie ihren wilden Reiz hat.
Südseeparadies bleibt eine Illusion
Das Noa-Noa-Südseeparadies gab es nie, wie Paul Gauguin in vielen Briefen in die Heimat verriet. Nach seiner Ankunft musste der Aussteiger, der rund 10 Jahre auf Tahiti lebte, feststellen, dass die französische Kolonialmacht dem vermeintlich unberührten Leben längst ihren Stempel aufgedrückt hatte: Konservendosen beim Lebensmittelladen, Prostitution im Hotel, viel Bürokratie im Hafen. Der Einzug der Elektrizität auf Tahiti verpasste ihm endgültig einen Schock.
Womöglich gerade deswegen erfand er sich als vermeintlich edlen Wilden im Sinne Rousseaus neu. Doch trotz folkloristischer Verkleidung, einem einfachen Leben in Holzhütten und in Abneigung zu den in seinen Augen “tatsächlichen Kolonialherren” blieb er doch immer der weiße Franzose mit Privilegiertenstatus.
Gaugins Vorstellungen nehmen Einfluss auf Expressionismus-Bewegung
Gauguin stellte die Bewohner Tahitis als "ursprüngliche" Menschen dar, frei von den Zwängen der westlichen Zivilisation und damit im Gegensatz zu dekadenten und korrumpierten Europäern. Seine Vorstellung von "Wildheit" hatte großen Einfluss auf die Expressionismus-Bewegung nach einer Kunst, die sich von der Rationalität, der Vernunft abgrenzt. Dabei war die Wildheit erfunden.
In seinen Bildern versuchte Gauguin nicht die Realität abzubilden, auch wenn er es vorgab. Sein fragwürdiges Inselleben war zwar nicht unbekannt, in der Kunstrezeption aber blieb es lange unwesentlich. Das ändert sich seit einigen Jahren durch zeitgenössische Arbeiten aus dem pazifischen Raum.
Wissenschaftliche Aufarbeitung beginnt gerade erst
Die Kunstwissenschaftlerin Caroline Vercoe forscht seit vielen Jahren an der Universität im neuseeländischen Auckland zur Bedeutung von Gauguins Werk und Leben. Bisher steht sie damit weitgehend alleine da, eine breitere wissenschaftliche Aufarbeitung hat gerade erst begonnen.
Wenn Künstler aus der Pazifikregion auf Gauguins Bilder junger Frauen schauen, lassen sie sich nicht blenden von den schönen Farben, sie reagieren vor allem mit viel Kritik.

2022 war diese Kritik auch in Berlin zu hören: in der Ausstellung “Why are you angry?”, die auch in der Alten Nationalgalerie gezeigt wurde. Ralph Gleis, Leiter der Alten Nationalgalerie, war zugleich Kurator der ursprünglich in der Kopenhagener Ny Carlsberg Glyptothek konzipierten Schau. Kritische Stimmen aus dem Südseeraum kamen da zu Wort und zeigten bereits mehrfach ihre Perspektive.
Ein großartiges Beispiel gab es auf der letzten Biennale in Venedig zu sehen. Im neuseeländischen Pavillon präsentierte die Künstlerin Yuki Kihara aus Samoa das “Paradies Camp“. Dafür hat sie einige von Gauguins Bildern nachstellen lassen, und zwar von Mitgliedern der Fa’afafine.
Die Fa’afafine sind eine Art drittes Geschlecht, in Tahiti kulturell verankert. In der Berliner Ausstellung „Why are you angry?” konfrontierte die interdisziplinäre Künstlerin Gauguins Werke zudem mit einer queeren Fernsehshow.
Es war erfrischend, in diesen Videos zu sehen, wie einfach dort aus der queeren Community die Menschen sich Bilder angeschaut haben, als hätten sie noch nie etwas von diesem Künstler gehört. Und fragen sich dann, ob er wohl die Porträtierten gut darstellt, ob die gut aussehen, ob man sich selber so porträtieren würde – also Fragen, die wir uns eigentlich gar nicht mit Gauguin stellen würden. Das verschiebt unsere Perspektive auf diesen Künstler noch mal total.
Ob es einem gefällt oder nicht: Rund um die Welt ist Gauguins künstlerisches Erbe zu sehen, seine Darstellungen tahitianischer Frauen, seine Stereotype. Ihn zu canceln wäre schwer. Wer einen neuen Blick auf Gauguins Kunst und Person schaffen will, muss neue Perspektiven anbieten. Nur sie können eine Diskussion über Moral anstoßen, einordnen und einen differenzierten Umgang mit der damaligen Lebensrealität finden. Im besten Fall einen für immer post-kolonialen Umgang mit den Werken Paul Gauguins.
SWR 2023