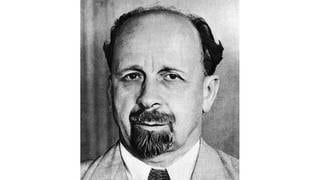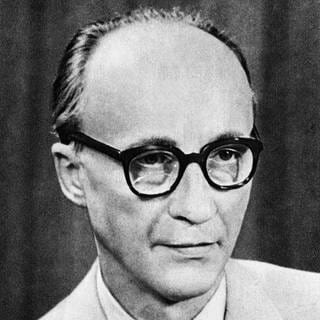Am 17. Juni 1953 gehen in Ost-Berlin und an vielen Orten in der DDR mehr als eine Million Menschen auf die Straße, um gegen das SED-Regime zu protestieren.
Live-Reportagen im RIAS spielen bei der Vermittlung der Ereignisse an dem Tag eine wichtige Rolle, sagt Dr. Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin. Das SED-Regime ist von den Demonstrationen überrascht und behauptet, sie seien mithilfe des "West-Radios" organisiert worden.
Die friedlichen Proteste werden von sowjetischen Panzern gewaltsam beendet. Es gibt Todesopfer. Rund 15.000 Menschen werden in der Folge verhaftet und verurteilt.
Den Artikel zur Sendung finden Sie auf tagesschau.de