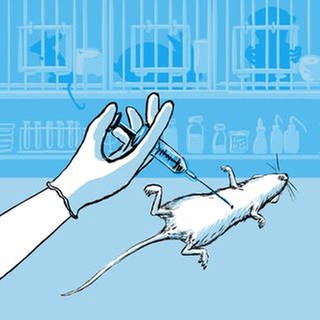Menschen und Tiere – es ist eine lange Geschichte der Trennung, Annäherung, Freundschaft und Ausbeutung.
Menschenaffen vor und hinter dem Zaun
Pongoland – so heißt das fast drei Hektar große Affengehege des Leipziger Zoos. Es ist die größte Menschenaffenanlage der Welt. Und noch etwas ist besonders: Dieser Teil des Zoos gehört dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Die Affen sind nicht nur eine Hauptattraktion für die Zoobesucher, sie dienen auch der Forschung. Der Psychologe Daniel Hanus will dort verstehen, warum Menschen sich heute wie Menschen verhalten – und Schimpansen wie Schimpansen.
"Wir haben gemeinsame Vorfahren, das ist gar nicht so lange her, bei Schimpansen ungefähr sechs Millionen Jahre. Und dann muss irgendwas passiert sein. Was könnte das gewesen sein? Und wie können wir Spuren davon jetzt noch finden, im heutigen menschlichen Verhalten und dem heutigen Verhalten bei nichtmenschlichen Affen?"
Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans, Bonobos – und Menschen. Im Pongoland des Leipziger Zoos treffen alle fünf Menschenaffenarten aufeinander. Wir gucken uns an und sehen uns selbst: die Gesten, die Blicke, das Gruppenverhalten. Eigenschaften, von denen man früher dachte, sie seien exklusiv menschlich, hat die Forschung eine nach der anderen auch bei Tieren gefunden. Je genauer wir hinsehen, desto weniger Unterschiede lassen sich eindeutig ausmachen. Auch Tiere nutzen Werkzeuge, haben eine Persönlichkeit und Kultur, führen Kriege, haben ein komplexes Erinnerungsvermögen. Selbst das Gehirn des Homo sapiens ist nicht das größte. Beim Pottwal wiegt es bis zu zehn Kilo, beim Kolibri macht es ein Fünfundzwanzigstel des Körpergewichts aus, doppelt so viel wie beim Menschen.

Und doch gibt es eine ganz klare Grenze, im Leipziger Zoo ist sie nicht zu übersehen: Wir kommen und gehen, die anderen Affen haben wir eingesperrt. Wir stellen sie zur Schau, füttern sie, experimentieren mit ihnen – und fühlen uns überlegen.
Auch Julia Fischer ist Verhaltensforscherin, war früher am Leipziger Max-Planck-Institut und arbeitet jetzt am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen und auf einer Forschungsstation im Senegal. Sie betont den Unterschied zwischen Menschen und anderen Affen:
"Ich würde sagen: Der Mensch ist der einzige Affe, der sich darüber Gedanken macht, wie er sich von anderen Affen unterscheidet. Diese Selbstreflexion, die ist für mich unabdingbar verknüpft mit Sprachfähigkeit. Also wir sind in der Lage, unheimlich schnell alles mögliche Neue in unserer Gesellschaft zu bezeichnen und uns zu verständigen. Das ist ein massiver Unterschied zur Kommunikation bei nicht-menschlichen Primaten."
Die Sprache ist der Schlüssel
Warum haben Menschen diese Fähigkeit entwickelt, Schimpansen aber nicht? Die Archäologin Valeska Becker beschäftigt sich mit dieser Frage. Ihre Antwort reicht ein bis zwei Millionen Jahre zurück, in die Zeit, in der die ersten Menschen lernten, das Feuer zu zähmen:
"Der Umgang mit dem Feuer, der dann erlaubt, Nahrung aufzuschließen, sodass man Nahrung besser verdaulich machen kann, dass man auch Krankheiten eindämmen kann, die von Genuss von rohem Fleisch ausgehen, dass man dann dadurch Zeit gewinnt, miteinander zu sprechen, nachzudenken, also Muße zu haben – das ist, glaube ich, ein Einschnitt, wo ich sagen würde: Da trennen sich Menschen und Tiere.
Valeska Becker forscht an der Universität Münster im Rahmen der sogenannten Human-Animal-Studies, einer kleinen und recht neuen Wissenschaftsdisziplin, die sich mit dem Verhältnis von Mensch und Tier beschäftigt. Bis weit in die Altsteinzeit hinein könne darüber allerdings nur spekuliert werden, sagt die Archäologin. Das ändere sich erst mit dem Auftauchen der ersten Höhlenmalereien vor rund 60.000 Jahren. Besonders fasziniert sie das berühmte Pferd aus der Höhle von Lascaux im heutigen Frankreich.

"Die Menschen, die diese Bilder gemacht haben, die kannten sich einfach top aus. Also eine ganz, ganz große Nähe zum Tier, ein Wissen um das Aussehen, aber auch das Verhalten dieser Tiere. Ich denke, dass diese Bilder nicht auf ein großes Gefälle zwischen Menschen und Tieren hinweisen, sondern eher auf ein Gefühl der Abhängigkeit, der Angewiesenheit auf das Tier und dass wir hier keine wirkliche Hierarchie sehen können."
Erst sehr viel später, vor rund 30.000 Jahren, begannen Menschen mit der ersten Domestizierung eines Tieres. Aus dem Wolf wurde der Hund. Blickten die Menschen der Altsteinzeit noch zu den Wildtieren hinauf, entwickelte sich mit dem Hund eine Beziehung auf Augenhöhe, eine wechselseitige Annäherung.

Der Wolf, das erste domestizierte Tier
Ein Hund fordert Aufmerksamkeit. Und die wiederum bringt Nähe. Der Hund wurde zum Familienmitglied. Die Zeit der Nutztiere begann erst sehr viel später, als vor rund 12.000 Jahren die letzte Eiszeit zu Ende ging. Es wurde wärmer, die Niederschläge nahmen zu, gewaltige Tierherden zogen durch die Graslandschaften. Im sogenannten fruchtbaren Halbmond, der sich vom Nildelta über das Tote Meer und das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris bis an den Persischen Golf erstreckt, fanden erstmals größere Menschengruppen zusammen, wurden sesshaft, begannen mit dem Anbau von Getreide.
Die Siedlungen wuchsen, die Jagd wurde schwieriger. Und die Menschen begannen, Schafe und Ziegen zu halten. Wichtiger als ihr Fleisch waren dabei die Sekundärprodukte: zuerst Milch, das ist anhand von Ablagerungen am Boden 9.000 Jahre alter Keramikkrüge nachgewiesen. Bald auch Wolle, und mit der Erfindung des Rades dann schließlich die Kraft der Tiere, um Pflüge und Wagen zu ziehen. Für die Nutzung dieser Sekundärprodukte mussten die Tiere nicht getötet werden. Und das hatte schwerwiegende gesellschaftliche Folgen, sagt Valeska Becker.
"In dem Moment werden Tiere zu einem wertvollen Besitz. Das heißt, ich kann meinen Besitz mehren und ich kann mehr haben als andere. Manchen gelingt das besser, anderen weniger. Und so bilden sich nach und nach Hierarchien heraus, Hierarchien in der Gesellschaft. Hierarchien aber auch zwischen Menschen und Tieren."
Diese neue Haltung zeigt sich auch, wenn die Archäologin bei Ausgrabungen auf Tiernachbildungen aus dieser Zeit stößt. Die sind eher klein, stark stilisiert und oft aus Ton.
"Ich kann diese neuen Tierfiguren zerschlagen, ich kann die dorthin positionieren, wo es mir gefällt. Und das spiegelt so ein bisschen wider, was man natürlich auch mit den Haustieren machen kann. Ich kann die schlachten, töten, ich kann die Herde hintreiben, wo es mir passend erscheint."
Mit der Zucht begannen die Menschen, Tiere auch genetisch zu verändern. Heute sind Haus- und Nutztiere früher geschlechtsreif als ihre wilden Vorfahren; sie bekommen mehr Junge, wachsen schneller heran, geben mehr Milch und Wolle, haben mehr Rippen für zusätzliche Koteletts. In der gezielten Zucht zeigt sich eine weitere Fähigkeit, die den Menschen klar von anderen Tieren unterscheidet, sagt der Entwicklungspsychologe Hannes Rakoczy. Er forscht am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen:
"Züchtung ist ja etwas, was per se einen langen Atem, eine mentale Zeitreise erfordert: Wie möchte ich diese Hunde oder Schafe künftig haben? Und wie komme ich dort hin? Die Schritte sind so lang, dass sie meine Lebenszeit übersteigen."

Heute leben wir in einer Industriegesellschaft. Tiere haben ihren zugewiesenen Platz: Nutztiere werden in Ställen oder auf eingezäunten Wiesen gehalten, für unsere Haustiere kaufen wir das Futter im Supermarkt und bringen sie zum Tierarzt, wenn sie krank sind. Selbst Wildtiere werden überwacht und ihr Bestand wird kontrolliert. Am vorläufigen Ende unserer langen Beziehungsgeschichte sind wir Menschen zu Herrschern über die Tiere geworden. Und das bedeutet auch: Wir tragen die Verantwortung für ihr Leben und Überleben.
SWR 2022