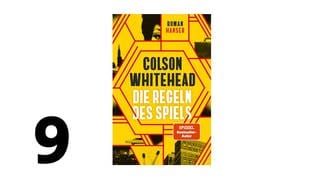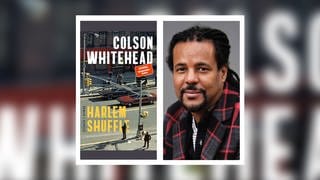Schießereien, Raub, Rassenunruhen, Korruption und ständig Brandstiftungen – willkommen im Harlem der Siebziger Jahre. In seinem Roman „Die Regeln des Spiels“ fängt Colson Whitehead mit Witz den angekränkelten Spirit New Yorks in seiner düstersten Dekade ein und zeichnet ein Wimmelbild der kriminellen Szene.
Ray Carney ist „anständig“ geworden. Der aus „Harlem Shuffle“ vertraute Teilzeitkriminelle und Hehler, der eine Frau aus dem bürgerlichen schwarzen Juristenmilieu geheiratet hat, betreibt nun erfolgreich sein Möbelgeschäft und frönt seinem Faible für schöne Sessel, Schränke, Tische. Die Wirklichkeit draußen vor seinen Schaufenstern in Harlem aber ist weniger zivil:
Es war ein herrlicher Junimorgen. Die Sonne schien, die Vögel sangen, die Rettungswagen heulten, und das Tageslicht, das auf die Tatorte der vergangenen Nacht fiel, ließ das Blut glitzern wie Tau in einem grünen Himmel.
Harlem 1971: ein Katastrophengebiet
Im Nixon-Jahr 1971 wird Harlem allmählich zum Katastrophengebiet. Die Black Liberation Army setzt auf gewaltsamen revolutionären Widerstand in den Städten, und die Schusswechsel auf den Straßen, die Kriminalität und die Verwahrlosung nehmen ein ungekanntes Ausmaß an. Ganze Straßenzüge sind dem Verfall preisgegeben, Wohnblöcke brennen, weil Brandstifter ihrer Passion nachgehen oder, noch öfter, weil Spekulanten und Versicherungsbetrüger an der Immobilien-Brandrodung gut verdienen. Mittendrin Ray Carney, entschlossen, seine neubürgerliche Existenz zu verteidigen:
In seinem Ruhestand hatte sich Carney den braven und anständigen Leuten zugesellt, hatte die Vorhänge zugezogen, wenn ein Stück weiter Schüsse zu hören waren und die Berichte über die Grabenkämpfe und blutige Auseinandersetzungen in der Morgenzeitung mit Grummeln bedacht.
Bis zu dem Tag, als seine geliebte Tochter ihn um Karten für ein Konzert der Jackson 5 bittet. Leider ist das Konzert restlos ausverkauft. Deshalb reaktiviert Ray einen Kontakt aus seiner Vorzeit. Es handelt sich um Detective Bunson, einen korrupten weißen Cop, Schutzgelderpresser und Fixer, der überall im Viertel seine Finger im Spiel hat und Premium-Tickets für die Jackson 5 sicher leicht beschaffen kann. Nur erwartet er dafür eine Gegenleistung – und wie eine Fussel im Staubsauger verschwindet, so saugt es Carney nun wieder in die geschäftige Unterwelt Harlems. Bald begleitet er Bunson auf eine albtraumhafte Rächer-Tour, bei der das Pulp-Blut in Strömen fließt.
„Die Regeln des Spiels“ ist ein Triptychon – der Roman besteht aus drei langen, novellenartigen Teilen, verbunden durch den Schauplatz und die Figuren. Im zweiten Teil kehrt ein weiterer Bekannter aus „Harlem Shuffle“ wieder: der Rausschmeißer und Schenkelbrecher Pepper, ein Mann für besondere Aufträge:
Peppers Persönlichkeit ließ sich nicht verbergen, sie entsprach dem Dezember, wenn die Tage immer kürzer werden: kalt und erbarmungslos… Er war nicht da, um einem einen überdimensionierten Scheck von der Lotteriegesellschaft oder eine Einladung zum Abendessen von Raquel Welch zu überreichen. Pepper war ein Abgesandter der hässlichen Seite der Dinge.
Inzwischen arbeitet er als Wachmann bei einer Blaxploitation-Filmproduktion, die der Roman mit viel Liebe zum popkulturellen Detail beschreibt. Als die Hauptdarstellerin plötzlich verschwindet, wird Pepper mit der Suche beauftragt – woraus sich wiederum eine Tour de Force durch die Harlemer Unterwelt ergibt, bei der Pepper einige Dealer, Gangster, Messerstecher das Fürchten lehrt. Bis sich herausstellt, dass die deprimierte Diva, die sich eine zugkräftige Gettobiographie bloß angedichtet hat, nur mal für ein paar Tage bei ihrer Mutter in einem gutbürgerlichen Vorort untergeschlüpft ist.
Der dritte Teil schließlich spielt 1976 vor dem kontrastierenden Jubel-Hintergrund der Zweihundertjahrfeier New Yorks und beschäftigt sich eingehend mit den notorischen Brandstiftungen und deren Hintermännern in Business und Politik. Und mit fehlgeleiteter Stadtplanung, die Schwarze systematisch benachteiligt und „Abwickler“ wie Wilbur Martin profitieren lässt.
Ein Abwickler erlöste ein Gebäude von seinem Elend... Der Besitzer pfeift aus dem letzten Loch – Steuern bis zum Gehtnichtmehr, Junkies nisten sich ein. Also verkauft er das Gebäude an den Abwickler, der die elektrischen Leitungen, die Rohrleitungen, alles, was sich zu Geld machen lässt, rausreißt und den Laden dann für die eigens erhöhte Versicherungssumme abfackelt. „Wenn du Wilbur durchs Treppenhaus gehen und die Hütte taxieren siehst, schaust du dich am besten nach einem anderen Platz um, wo du deinen Hut aufhängen kannst.“
Ein Stil wie Jazz-Musik
Die siebziger Jahre gelten als düsterste Dekade New Yorks. Der „rotten apple“ war eine beinahe scheiternde und bankrotte Stadt. Der Roman liest sich dennoch als Hommage auf den Hexenkessel Harlem. Whitehead verbindet soziologisch-ethnographisches Erzählen mit einem verspielten Stil, der etwas Tänzelndes, Jazziges hat.
Die Handlung der drei Teile ist gleichermaßen actionreich und marginal. Es wird geprügelt und geschossen – und Whitehead erzählt von den Gewaltexzessen ganz beiläufig in einem humorig-aufgekratzten Ton, als gehöre dergleichen nun einmal zur ortsüblichen Gangster-Folklore. Alles scheint gleich wichtig in seinem zwar ungemein detailfreudigen, aber zugleich auch alles einebnenden, auf gleicher Bedeutungshöhe verhandelnden Erzählverfahren. Der comedyhafte Witz bewährt sich vor allem, wenn die Kontexte wirklich komisch sind, etwa wenn die joviale Schreckensfigur Pepper von der Besitzerin eines aufstrebenden Chicken-Restaurants beauftragt wird, das Hähnchenrezept ihrer schärfsten Konkurrentin zu klauen und dafür belohnt wird mit lebenslang Gratishähnchen.
Keine wirkliche Geschichte in Whiteheads Wimmelbild
„Nur an Originalschauplätzen gedreht“ – so wird der Film des Mittelteils beworben. Das Etikett würde auch für diesen Roman passen, in dem Whitehead mit unüberbietbarer Ortskenntnis den Spirit von Harlem einfängt und ein Wimmelbild der komplexen kriminellen Strukturen zeichnet. Aber diese Authentizität bleibt äußerlich. Zwischen all dem Pulp und Pop sucht man vergebens nach einer Geschichte, die einen wirklich berühren und fesseln würde. Weil sie fehlt, fällt einem auch die konzentrierte Aufmerksamkeit schwer, die nötig ist, um bei der verwinkelt erzählten Handlung mit ihren vielen Abschweifungen nicht den Überblick zu verlieren.
Platz 9 (31 Punkte) Colson Whitehead: Die Regeln des Spiels
New York, 1971. Ray Carney will nichts mehr mit illegalen Machenschaften zu tun haben. Doch seine Tochter wünscht sich eine Karte für ein Konzert der Jackson 5. Also muss Ray seine alten Kontakte reaktivieren.
Gespräch Colson Whitehead - Harlem Shuffle
„Eine Ratte, die sich unter der Tür durchquetscht“ – so beschreibt sich der Möbelhändler Ray Carney. Er ist schwarz und versucht, im Harlem der späten 50er Jahre eine bürgerliche Existenz aufzubauen. Mit sauberen Mitteln gelingt das nicht. Colson Whitehead, neuer Star der amerikanischen Literatur, erzählt ein weiteres Kapitel aus der schwarzen Geschichte Amerikas. | Alexander Wasner im Gespräch mit Frank Hertweck. | Hanser Verlag, 384 Seiten, 25 Euro | ISBN 978-3-446-27090-9