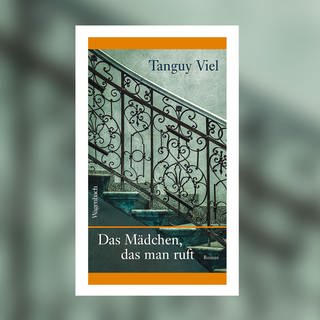Tessa Ensler ist eine junge Staranwältin und spezialisiert auf die Verteidigung mutmaßlicher Sexualstraftäter. Dann aber wird sie von einem Kollegen vergewaltigt und findet sich plötzlich selbst im Zeugenstand wieder. Suzie Millers MeToo-Monolog „Prima facie“ wurde weltweit ein Theaterhit. Nun hat die australische Dramatikerin daraus einen Roman gemacht.
„Prima facie“, das bedeutet im Lateinischen so viel wie „dem ersten Anschein nach“. Juristen verwenden diesen Terminus, wenn man einen Sachverhalt so bewerten muss, wie er sich eben auf den ersten Blick präsentiert. Einfach, weil weitere Beweise fehlen. Ein Rechtsgrundsatz, der vor allem bei der Behandlung von Sexualdelikten eine Rolle spielt. Wenn es um die Frage der Einvernehmlichkeit beim Sex geht, wenn Aussage gegen Aussage steht, kommen mutmaßliche Täter meist davon.
„Prima facie“ heißt auch der Debütroman der australischen Dramatikerin Suzie Miller, die selbst viele Jahre lang als Strafverteidigerin gearbeitet hat. Schwerpunkt: Sexualdelikte. Ihr 350-Seiten-Werk nun basiert auf ihrem gleichnamigen Metoo-Monolog über eine brillante Strafverteidigerin, die sich nach einer Vergewaltigung selbst im Zeugenstand wiederfindet. Und die plötzlich die Welt nicht mehr versteht.
»Wenn ich als Verteidigerin in Sexualstrafsachen Frauen vernommen habe, bin ich davon ausgegangen, die Beweise ließen sich klar und logisch aufdröseln wie ein ordentlich verschnürtes Päckchen. (…)« Ich atme tief durch. Die Luft im Saal ist geladen. »Jetzt weiß ich, dass das nicht richtig war. Nicht angemessen. Denn jetzt weiß ich, aus eigener Erfahrung, sowohl als Frau als auch als Anwältin, dass die gelebte Erfahrung sexualisierter Gewalt sich nicht als ordentliches, stimmiges und systematisches Päckchen einprägt. Dennoch geht das Gesetz genau davon aus.« (336 f.)
Die Theaterwelt erobert
Mit ihrem eindringlichen Ein-Frauen-Stück, 2019 in Sydney uraufgeführt, hat Miller die Theaterwelt erobert und dabei praktisch alle wichtigen Preise abgeräumt. „Prima facie“, das ist ein verzweifelter Schrei nach Reform eines, in Millers Augen, zutiefst patriarchalischen Rechtssystems, das seinen Zuschauerinnen und vor allem Zuschauern auch nach der Aufführung noch lange in den Ohren gellt. In Großbritannien hat es sogar zu einem neuen Leitfaden für Geschworenen-Jurys geführt.
Der Erfolg von Millers Stück soll sich nun also in Romanform wiederholen. Millers Hauptfigur ist wie im Stück Tessa Ensler, die junge Londoner Anwältin, die es trotz ihrer Herkunft aus einer kaputten Arbeiterfamilie bis ganz nach oben geschafft hat. Dabei wurde aus dem Ich-Monolog naheliegenderweise eine Ich-Erzählung, bei der sich nun der Leser gleichsam in der Rolle eines Geschworenen befindet. Im Unterschied zum Stück stellt der Roman in Rückblenden den familiären Hintergrund der Protagonistin breiter dar, darunter auch Nebenfiguren wie Tessas Bruder, der schon früh mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Damit stärkt die Autorin zwar den Klassismus-Aspekt ihrer Geschichte, doch verliert diese in Romanform erheblich an Wucht und Drive.
Im Übrigen enttäuscht die Romanfassung durch ihren Mangel an narrativen Mitteln: Jedes Kapitel, egal ob es vor oder nach der Tat, während Tessas Zeit an der Uni oder später in der Kanzlei spielt, ist in der Gegenwartsform erzählt. Damit ist der Bewusstseinsunterschied zwischen der erlebenden und der erzählenden Hauptfigur automatisch eingeebnet, ein rückblickendes Reflektieren daher nur noch eingeschränkt möglich.
In der ersten Romanhälfte erleben wir Millers Ich-Erzählerin wie im Stück als von sich selbst berauschte Powerfrau auf der Erfolgsspur. Reihenweise bewahrt sie ihre Mandanten vor den Klauen des Rechtssystems: ob sie nun selbstbewusst die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft durchlöchert oder einfach nur das entscheidende Gran Zweifel in den Köpfen der Geschworenen platziert. Eine Sache hat die Strafverteidigerin sogar regelrecht zur Kunstform erhoben: das Kreuzverhör von Frauen, die Tessas Mandanten einer sexuellen Straftat bezichtigen.
Nie habe ich eine Frau als Lügnerin bezeichnen müssen, um zu demonstrieren, dass ihre Geschichte Schwachstellen aufweist. Ich muss es lediglich suggerieren. Jurys sind gut darin, zwischen den Zeilen zu lesen, besonders, wenn man auf eine bestimmte Art und Weise mit den Klägerinnen spricht. Wenn man sie nicht fertigmacht, sondern nur entlarvt. (253 f.)
Nur ein gemietetes „Sprachrohr“
Ein schlechtes Gewissen hat Tessa dabei zunächst nicht. Warum auch? Schließlich ist ihre Rolle vor Gericht, wie die Anwältin auffällig oft wiederholt, nur die eines gemieteten „Sprachrohrs“. Als solches präsentiert sie den Geschworenen einfach nur eine Gegen-Erzählung, eben die Version des Angeklagten. Ob dieser die Tat begangen hat oder nicht, das will Tessa gar nicht wissen. Im Übrigen, so erklärt die Protagonistin treuherzig, müsse man eben darauf vertrauen, dass das System keinen Schuldigen davonkommen lässt; in ihrer Verantwortung liege dies jedenfalls nicht.
Wie im Stück, so wird auch im Roman Tessas Vertrauen in das Rechtssystem im Lauf der Geschichte gründlich zerstört. Dann nämlich, als sie selbst Opfer einer Vergewaltigung wird und darauf angewiesen ist, Gehör und Glauben zu finden. Denn auch in ihrem Fall geht es um ein „He said, she said“, wie es im Englischen heißt, ein „Aussage gegen Aussage“. Schließlich hatte Tessa ihren Arbeitskollegen, den ach so sensibel wirkenden Julian aus renommierter Juristenfamilie, selbst zu sich eingeladen. Und hatte mit ihm zunächst auch leidenschaftlich-einvernehmlichen Sex, sogar nach „allen der Regeln der Kunst“, wie es in bester Romance-Manier heißt. Nur der Geschlechtsverkehr, der danach noch folgte, fand gegen Tessas ausdrücklichen Willen statt. Wie schwierig ihr Fall vor Gericht werden würde, dämmert Millers Protagonistin schon auf der Polizeistation:
»Und wenn er behauptet, wir hätten gar keinen Sex gehabt? Wie soll ich das beweisen?«
Aber dann fällt mir ein: »Natürlich wird er zugeben, dass wir Sex hatten. Er wird nur behaupten, dass es einvernehmlich war … oder?«
Der Polizist lehnt sich auf seinem Stuhl zurück, eine Hand im Nacken. »Sobald er so einen Verteidigerarsch an seiner Seite hat, kann er alles behaupten.« (205)
Anwältin ohne Empathie?
Bekanntlich gibt es ja auch im richtigen Leben Menschen, die zu bestimmten Einsichten erst kommen, wenn sie selbst einschlägige Erfahrungen machen mussten. Millers Ich-Erzählerin ist da keine Ausnahme – in ihrem Fall aber überzeugt die Wandlung nicht. Denn die Autorin tut so, als gehörte zum Anwaltsberuf nicht ein Mindestmaß an Empathie. Der klischeehafte Erkenntnissprung ihrer Protagonistin wirkt so unglaubwürdig wie Tessas entsetzte Überraschung, als sie von ihrem eigenen Anwalt erfährt, die Verurteilungsquote bei derartigen Delikten betrage in England nur 1,3 Prozent. Eine Zahl, die in der Tat sprachlos macht und nach Veränderungen ruft. Aber sie, die gestandene Strafverteidigerin, kannte sie nicht? Nein, Millers Hauptfigur hat allen Ernstes gedacht, es wäre allein ihr eigenes Können, das ihren Mandanten Freisprüche bescherte – und nicht ein strukturell misogynes Rechtssystem.
Alles in allem wirkt „Prima facie“ als Buch weniger wie ein Roman und mehr wie eine Filmvorlage. Die Verfilmung soll übrigens auch bald in die Kinos kommen – vielleicht lohnt es sich, bis dahin zu warten.
Mehr Bücher zum Thema MeToo
Buchkritik Virginie Despentes – Liebes Arschloch
Geschlechterkampf als famoser Mail-Roman: In „Liebes Arschloch“, dem neuen Bestseller der französischen Star-Autorin Virginie Despentes, fetzen sich eine Schauspielerin und ein Schriftsteller über Reizthemen wie Feminismus, MeToo und soziale Medien – und verfolgen ein großes gemeinsames Ziel: Endlich nüchtern werden. | Rezension von Wolfgang Schneider | Aus dem Französischen von Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis | Kiepenheuer & Witsch Verlag, 336 Seiten, 24 Euro | ISBN 978-3-462-00499-1
Gespräch Amia Srinivasan – Das Recht auf Sex
Amia Srinivasan gilt als junge Star-Philosophin aus Oxford. Ihr Essayband über Sex, Macht und Politik wird als neues feministisches Manifest gefeiert. Jetzt ist „Das Recht auf Sex“ auf Deutsch erschienen – aber so viel Neues zum Thema Feminismus steht gar nicht drin.
Lukas Meyer-Blankenburg im Gespräch mit Silke Arning.
Aus dem Englischen von Anne Emmert und Claudia Arlinghaus
Klett-Cotta Verlag, 320 Seiten, 24 Euro
ISBN 978-3608982381
Buchkritik Tanguy Viel - Das Mädchen, das man ruft
MeToo in der französischen Provinz: Eine junge Frau gerät in ein kompliziertes Abhängigkeitsverhältnis, ein alter Boxer will es noch einmal wissen, ein gieriger Politiker nimmt, was er bekommen kann. Aus diesen Elementen strickt der französische Autor Tanguy Viel in "Das Mädchen, das man ruft" eine pointierte Erzählung über Machtmissbrauch und festgefahrene gesellschaftliche Strukturen. | Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel | Wagenbach Verlag, 154 Seiten, 20 Euro | ISBN 978-3-8031-3345-8