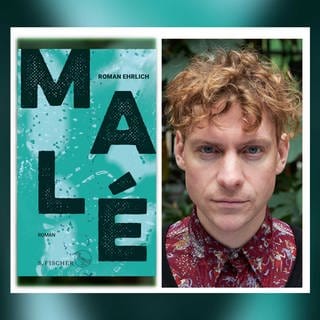Die 26 Jahre alte Autorin Helene Bukowski entwirft in ihrem Debüt „Milchzähne“ eine düstere dystopische Parabel voller Spannungen: Zwischen Fernweh und Heimatgefühl, Mutter und Tochter, der Gruppe und dem Fremden. Ein starker Kommentar zu unserer erhitzten Gegenwart und zugleich ein beeindruckender Roman übers Erwachsenwerden.
Die Mutter verkriecht sich im Kleiderschrank
Manchmal hockt Edith tagelang im Kleiderschrank und starrt die Wand an. Bilder vom Meer hängen dort, Erinnerungen an ihre Herkunft. Der Schrank ist ein Refugium in einem Refugium in einem Refugium. Denn Edith wohnt zurückgezogen mit ihrer Tochter Skalde in einem heruntergekommenen Haus am Rande einer Gemeinschaft, die sich vor Jahren infolge einer Klimakatastrophe von der Außenwelt abgekapselt hat.
So heißt es: „Ediths Schrank nahm eine ganze Wand ihres Zimmers ein. Die Spiegeltüren ließen den Raum doppelt so groß erscheinen. Kein einziges Kleidungsstück hing mehr auf den silbernen Bügeln. Wenn ich die Schranktüren öffnete, bewegten sie sich klimpernd im Luftzug. Die Innenwände hatte Edith mit Bildern vom Meer tapeziert: Sandstrand. Helle Dünen. Angespülte Algen. Bemooste Wellenbrecher. Ein Pier im Nebel. Eine ausgebombte Strandpromenade. Sie betrat das Zimmer nur noch, um sich in den Schrank zu setzen und die Bilder im Licht der Taschenlampe zu betrachten."
Hörbuch Eine verstörende Zukunftsvision als Hörbuch – „Milchzähne“ von Helene Bukowski
„Eine Gesellschaft nach dem Kollaps. Eine Gemeinschaft, die aus Angst mordet. Laura Balzer liest Helene Bukowskis aufwühlende Dystopie ‚Milchzähne‘“.
Eine geschlossene Gesellschaft voller Spannungen
Das Meer im Kleiderschrank: Näher können sich Weite und Enge nicht kommen.
„Milchzähne“, das Debüt der 1993 in Berlin geborenen Autorin Helene Bukowski ist voller Spannungen. Zwischen Fernweh und Heimatgefühl, Mutter und Tochter, Insidern und Outsidern, der Gemeinschaft und dem Fremden.
Für die junge Skalde gilt: Die Grenzen ihres Grundstücks sind die Grenzen ihrer Welt. Was es jenseits der Brombeerhecke gibt, erfährt die Ich-Erzählerin zunächst nur aus Büchern, die überall in der zugemüllten Wohnung herumliegen. Aber als sie ihren ersten Milchzahn verliert, bricht sie aus, erkundet die Landschaft.
Am nächsten Tag verließ ich das Grundstück. Ich wollte mich nicht mehr an Ediths Regel halten. Der Wald stand, als hätte er all die Jahre auf mich gewartet. Ich untersuchte die Rinde der Kiefern, verschob Nadeln auf dem Boden, steckte zwei Tannenzapfen in die Tasche meines Regenmantels und lag, bis es dunkel wurde, in einer Kuhle zwischen den Wurzeln, den Blick in den Zweigen über mir. Ich verstand, dass ich auch hier hingehörte und dass die Landschaft jenseits des Hauses, des Gartens, auch für mich gemacht war.
Ein Debüt mit scharfem Blick für die virulenten Themen
Helene Bukowski studiert Kreatives Schreiben in Hildesheim. Mit Institutsprosa und selbstbezüglicher Literatur-Literatur hat ihr Debütroman gleichwohl nichts zu tun.
Denn diese Autorin verfügt über ein scharfes Sensorium, mit dem sie politisch virulente Themen glasklar erfasst. Und sie versteht es meisterhaft, daraus eine verstörende dystopische Parabel zu entwickeln. Eine Parabel auf die beiden parallel verlaufenden Klimawandel unserer Zeit, den meteorologischen und den sozialen.
Das fremde rothaarige Kind wird als Bedrohung empfunden
Etwas Furchtbares kommt auf die Bewohner des unbenannten Ortes zu: eine Rothaarige. Auf einer ihrer Exkursionen trifft die mittlerweile erwachsene Skalde auf Meisje, ein fremdes Kind. Die abergläubische Gemeinschaft würde das Mädchen mit den Hexenhaaren am liebsten gleich aufknüpfen.
Bald schon nähert sich eine kleine Menschengruppe dem Haus, in dem Skalde die Kleine versteckt hält. Sie sei in der Gemeinschaft nicht erwünscht, gehöre nicht zum Ort. „Allein schon die Haare“. Als wenig später zwei Bewohnerinnen verschwinden, verdächtigt die Gemeinde das Kind. Dann spitzt sich die Lage zu:
„Seit Jahren leben wir hier friedlich, dann taucht das Wechselbalg auf und nun das. Wie kann das nichts miteinander zu tun haben, erklär mir das?‘ Ich schwieg. Eggert wollte wieder einen Schritt auf mich zu machen, doch Levaii hielt ihn fest. ‚Das bringt sie uns auch nicht wieder‘, sagte sie zu ihm. ‚Drei Tage hast du Zeit, das Kind an uns auszuliefern. Sonst hole ich es mir‘, sagte er. Levaii zog ihn zurück zum Haus. ‚Drei Tage‘, wiederholte er. Ich stieg in den Pick-up und beeilte mich, vom Hof zu fahren. Im Rückspiegel sah ich, wie sie mir nachschauten. Erneut begannen die Schäferhunde zu bellen. Selbst als ich unser Haus erreichte, hatte ich noch das Gefühl, sie zu hören. In der Dämmerung verlor die Landschaft ihre Farbe."
Eine bizarre, surreale Welt
„Milchzähne“ spielt in einer unwirtlichen, menschenfeindlichen Gegend, an der sich allerlei bizarre Dinge ereignen: Möwen mit versengten Federn fallen wie in Lars von Triers „Melancholia“ vom Himmel, Doggen werden mit Rinde gefüttert, aus Kaninchenfellen werden schussfeste Mäntel genäht.
Es sind surreale Stimmungsbilder, die Bukowski in dunklen Gouachefarben malt. Mit äußerster sprachökonomischer Effizienz gelingt es ihr, eine immer beklemmendere Atmosphäre zu schaffen, die sich dem Leser wie eine Schlinge um den Hals legt und ihm langsam die Luft abschnürt.
Die Doggen verschwanden an dem Tag, an dem wir glaubten, es gäbe ein Gewitter. Gegen Mittag hatte der Himmel eine fast schwarze Farbe angenommen. Die schwüle Luft knisterte elektrisch aufgeladen.
Doch so sinnlich ihr Erzählen auch ist, die Autorin gibt uns mehr zu denken als zu sehen. Zwar leuchtet sie höchst kunstfertig und bedächtig die Hintergründe der Handlung an, aber vieles lässt sie auch im Halbdunkel stehen. Vieles bleibt bis zuletzt rätselhaft, skurril, befremdlich.
Kulturelle Abschottung lässt die Gemeinschaft verkümmern
Klar wird: Wer zu der verschworenen Ortsgemeinschaft zählt und wer nicht, das entscheidet sich an den Milchzähnen. Wer sie verliert, darf bleiben, wer sie behält, muss gehen. Oder wird, wie Edith, allenfalls geduldet.
Und noch etwas wird klar: Ein kultureller Protektionismus, der sich an artifiziellen Kriterien aufhängt und der die regenerative Kraft des Austauschs mit dem Fremden verkennt, führt zwangsläufig zur seelischen und moralischen Verkümmerung der Gemeinschaftsmitglieder. Sinnbildlich hierfür steht die Verwüstung der Landschaft. Mit jeder Buchseite wird es heißer. Am Ende bleibt nur noch die Flucht.
Das letzte Licht ließ die Stämme der Kiefern rot aufleuchten. Meisis lief voraus. Unter meinen Sohlen knisterte das Gras, als würde es sich gleich entzünden. Bevor ich in den Wald trat, schaute ich noch einmal zurück. Die Sonne versank hinter dem Haus. Der Himmel sah aus, als ob er brannte.
Schwer war mein Herz, während ich Abschied nahm. Unvorstellbar fühlte es sich an, zu wissen, dass ich nie wieder zurückkehren würde.
Engagierte Schwarzmalerei
Dystopische Literatur ist die engagierte Literatur der Gegenwart. Meist sind es tiefschwarze Zukunftsromane, die das Armageddon ausmalen, von selbstverschuldetem Verderben und Untergang handeln. Ihre Verfasser wollen uns damit wachrütteln. Wir sollen fundamental umdenken, echte Lösungen finden.
Die Jugendlichen sind die letzte Hoffnung der Menschheit
In „Milchzähne“, einem Kabinettstück des Genres, blitzt in vereinzelten Gesten der Solidarität noch so etwas wie Hoffnung auf. Und sie ruht – Greta Thunberg lässt grüßen – auf den Schultern einer alarmierten Jugend.