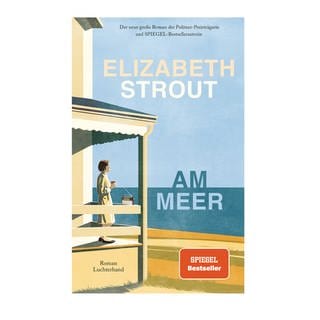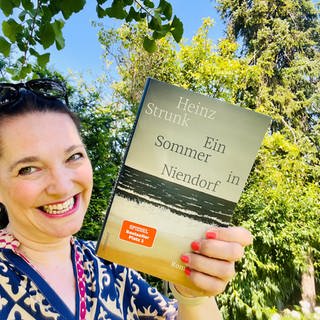Kindheit am Meer, endlose Sommerwochen, eine Großfamilie mit kauzigen Tanten und unzähligen Cousins, ein Abenteuer und eine Schule des Lebens: Der flämische Autor Eric de Kuyper erinnert sich in „An der See“ an die Nachkriegsjahre in Ostende – und an sein kindliches Ich.
Die Kindheit, ob sie glücklich verläuft oder desaströs, ist der Urquell des Schreibens. Manche Schriftsteller schöpfen ein Leben lang aus ihr, aus den Gerüchen und Gefühlen, der kindlichen Neugier und der ersten naiven Weltbegegnung. Manche kehren hin und wieder zu ihr zurück, um das Spielerische und den Zauber des Anfangs hervorzukitzeln. Eine gewisse Melancholie mag da immer mitschwingen, denn das ursprüngliche Vertrauen und die unschuldige Gewissheit ins Gelingen nutzen sich im Laufe des Lebens ab. So schleicht sich in den Blick zurück Wehmut ein, eine Sehnsucht nach Heimat, etwas, „das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war“, wie es bei Ernst Bloch so schön heißt. Auch Eric de Kuyper kennt diese Sehnsucht und die Fallstricke des Älterwerdens.
Schon als Kind hatte er vermutet, dass er beim Erwachsenwerden vieles von dem vergessen würde, was für das Leben, das glückliche Erleben des Alltags, unverzichtbar war. Wie zutreffend war diese Intuition gewesen, wie begründet seine panische Angst davor, erwachsen zu werden. Er würde vergessen und sich selbst untreu werden, das hatte er befürchtet.
Mit allen „Kinners“ nach Ostende
Vergessen etwa wird das intuitive Wissen um die Beschaffenheit und Verschiedenartigkeit des Sands, das durch ernsthaftes und weltabgeschiedenes Kinderspiel erworben wird. Wie viel in der Erinnerung aber doch bewahrt ist, wie diese Erinnerung auch den Älteren ins Kindheitsglück zurückzuversetzen vermag, das können wir in Eric de Kuypers „An der See“ nachlesen. Darin erzählt er, wunderbar übersetzt von Gerd Busse, wie die ganze Brüsseler Großfamilie de Kuyper die Sommermonate nach 1945 samt einer Schar von „Kinners“ unterschiedlichen Verwandtschaftsgrads in Ostende verbringt. Eine Vorkriegstradition wird so fortgeführt.
In den ersten Jahren nach dem Krieg waren die Häuser am Zeedijk fast alle vernagelt. Manche waren total zerstört, andere standen nur leer und waren unbewohnt. Von Jahr zu Jahr zeigten sie mehr Anzeichen von Leben: Hotels, Restaurants und Café-Terrassen öffneten, und kleine Läden kamen hinzu, in denen Postkarten, Fischernetze, Bälle, Tennisschläger, Badeanzüge, -kappen und Sonnenöl verkauft wurden.
Für den jungen Ich-Erzähler stellen die Wochen am Strand das eigentliche Leben dar: Die Sinne sind geschärft, er beobachtet das Treiben um sich herum, die Verhaltensweisen der Erwachsenen, deren Benehmen untereinander, deren Schwärmereien und Genervtsein, den gedankenverlorenen Blick rüber zur englischen Küste. Er erinnert sich an die endlosen Stunden des Spiels und Müßiggangs, an Freundschaften und die ersten erotischen Impulse, ritualisierte Freuden und überraschende Wendungen. Ostende ist Paradies und Schule in einem, eine sich endlos dehnende Zeit des Sammelns von Eindrücken und Empfindungen.
Die Sehnsucht nach dem Meer
…denn sie lebten schließlich einen ganzen Sommer lang am Strand, und zwar jedes Jahr, seit Menschengedenken und für immer und ewig.
Für immer und ewig, manchmal sogar in den geruhsamen, merkwürdig ereignislosen Tagen außerhalb der Saison – denn für das kränkliche Kind ist die Luft an der See auch eine Therapie. Dass der ältere Erzähler mit einer gewissen Schwermut zurückschaut, verwundert nicht und ist ihm nicht zu verdenken: Der Kindheit wohnt eine pralle, gedankenlose Gegenwärtigkeit inne, die der Schreibende durch die Sprache zurückbringen muss. Das Wunder des puren Daseins am Meer – es kann heraufbeschworen, aber nicht neuerlich erlebt werden.
Eric de Kuyper gelingt die sprachliche Vergegenwärtigung auf betörende Weise. Das liegt an seiner Fähigkeit, das jugendliche Ich in diesen autobiographischen Aufzeichnungen nicht zu sehr durch Erfahrungen des Erwachsenen zu trüben, seine Lust und Angst nicht nachträglich zu verniedlichen; und es gelingt ihm durch einen feinen Humor, der gerade in den Schilderungen von Tanten und Onkeln, Cousinen und Cousins aufblitzt und eine Stimmung erzeugt, die in uns nur einen Wunsch entfacht: sofort ans Meer zu fahren und in Erinnerungen zu baden.
Weitere Romane, die am Meer spielen
Fortsetzung von „22 Bahnen“ Caroline Wahl „Windstärke 17“ – Schuldgefühle nach dem Tod der Mutter
Die Mainzer Bestseller-Autorin erzählt in ihren Romanen einfühlsam von zwei Schwestern, die mit einer alkoholkranken Mutter aufwachsen. Auch „Windstärke 17“ hat den typischen Caroline-Wahl-Sound: Lakonisch, rhythmisch, reduziert.
Lesung und Diskussion Elizabeth Strout: Am Meer
Der literarisch gepflegte Plauderton lullt ein, doch unter dem Druck der Corona-Pandemie wird ein eigentlich getrenntes Paar gezwungen, Bilanz zu ziehen. Das Private wird dabei immer mehr vom Politischen überlagert. Strout zeigt ein Land in Aufruhr.
Lesetipp von Anja Höfer Heinz Strunk – Ein Sommer in Niendorf
Der Mann, das peinliche Wesen! Auch in Heinz Strunks neuem Roman geht es um einen mittelalten Mann, der mit sich, dem Leben und der Liebe hadert. Angesiedelt im sommerlichen Niendorf an der Ostsee, schreibt Strunk eine Art RTL2-Version von Thomas Manns „Tod in Venedig“. Keine besonders aufmunternde, aber eine sehr dynamisch erzählte und stellenweise rasend komische Sommerlektüre.
Rowohlt Verlag, 240 Seiten, 22 Euro | ISBN 978-3-498-00292-3