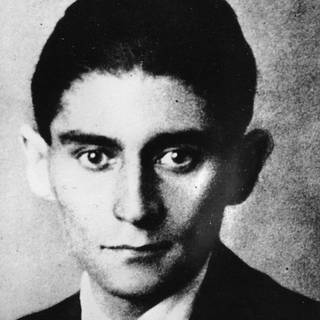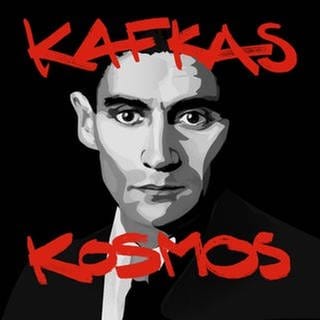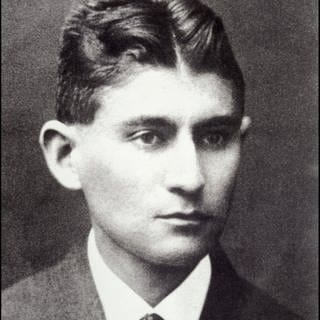Am 3. Juni vor einhundert Jahren ist Franz Kafka in Prag verstorben. „Kafkaesk“ wird zum sprichwörtlichen Ausdruck einer Befindlichkeit, deren Präsenz bis heute geradezu unheimlich gegenwärtig ist. In allen Kunstformen – der Literatur, der bildenden Kunst und dem Film – ist das Werk Kafkas reflektiert worden. Und natürlich auch in der Musik. Kafka selbst bezeichnete sich als unmusikalisch.
Franz Kafka und die Musik: Ein weites Feld ist das nicht, eher eine schmale Ackerfurche. Das ist erstaunlich, bedenkt man die Rezeption seines Werks, das ihn vielleicht zu dem, auf jedenfalls zu einem der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren für die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg gemacht hat. Wohl deshalb, weil in Kafkas Werk Existentielles steckt.
Kafka war unmusikalisch
Die Musik gehört nicht unbedingt dazu. Kurz vor seinem Tod entstand dann doch ein Text über Musik. „Josefine, die Sängerin“ handelt von der Kunst des Gesangs. Doch nur scheinbar, denn die Beurteilung solcher Kunst fällt dem Erzähler schwer.
Er stellt fest: „Wir sind ganz unmusikalisch.“ Wer ist dieses Wir? Kafka und die Angebeteten des ewigen Junggesellen? Er und der Freund Max Brod?

Dieser wohl kaum, war er doch durchaus musikalisch, komponierte und verfasste die deutschen Textfassungen der Opern des tschechischen Komponisten Leoš Janáček. Von ihm stammt die Bemerkung, Kafka hätte Léhars Operette „Die lustige Witwe“ kaum von Wagners Musikdrama „Tristan und Isolde“ zu unterscheiden gewusst.
Kafkas 100. Todestag Endloses Gedenken an einen Schriftsteller, der nichts davon gewollt hätte
Seit Jahresbeginn wird der 100. Todestag Franz Kafkas bis in die kleinsten thematischen Verästelungen zelebriert. Was bleibt am 3. Juni 2024, dem tatsächlichen Todestag, noch zu sagen?
Lieber Stille als Musik
In der Erzählung ist den Unmusikalischen Josefines Gesang ein Pfeifen, sie selbst kommen als Kinder nicht übers Piepsen hinaus. „Wir sind zu alt für Musik“, heißt es, „ihre Erregung, ihr Aufschwung passt nicht für unsere Schwere, müde winken wir ihr ab; wir haben uns auf das Pfeifen zurückgezogen.“
Die sinnliche Kraft und Macht der Musik wird keineswegs geleugnet, aber sie trifft nicht. Und das sicher nicht allein, weil das Wir des Textes das Volk der Mäuse ist, eine früh gealterte Gemeinschaft des Arbeitens, die für den Mythos des Gesangs keine Zeit hat. Und überhaupt: „Stiller Frieden ist uns die liebste Musik.“
„Das Schweigen der Sirenen“ trifft Kafkas Bild der Musik
Allerdings ist die Musik der Stille die ultimative Waffe in einem Text Kafkas, der auf die Dekonstruktion des Mythos von Odysseus zielt. Auch Odysseus weiß um die im Fall der Sirenen tödliche Verführung durch Musik. Er versucht sie zu überlisten und verstopft sich die Ohren mit Wachs. So braucht er ihre Musik nicht zu hören und muss ihr auch nicht erliegen.
Doch die Sirenen versuchen ihn zu täuschen, in dem sie mit offenen Mündern und sich wendenden Hälsen stumm bleiben. Odysseus sieht sie singen, hört sie aber nicht. Das Bild bleibt stumm, egal ob sich der Held nun die Ohren mit Wachs verstopft oder nicht.

Kafkas kurzer Text „Das Schweigen der Sirenen“ ist sein ultimatives Bild der Musik. Es ist das ihrer Abwesenheit. Als sei es eine Vorwegnahme von Adorno und Horkheimers Überlegungen in ihrer „Dialektik der Aufklärung“, ist Odysseus auch bei Kafka nicht der listige Held, sondern der aufklärerische Zerstörer aller Magie des Schönen, die die Musik als Verführerisches ist.
Kompositionen zu Erzählungen von Kafka
Wie um dieses Schweigen wieder hörbar zu machen, komponiert Rolf Riehm sein Stück „Odysseus hörte ihr Schweigen nicht“. Der Untertitel lautet: „Orchesterstück zu einer Erzählung von Franz Kafka“. Also nicht nach diesem Text, sondern dazu, als sei es die Begleitmusik zu dieser stummen Szene, fast wie eine Filmmusik.
Ins bildhaft Unheimliche einer sinfonischen Dichtung überführt Cristobal Halffter das Hybridwesen Odradek aus der Erzählung „Die Sorge des Hausvaters“. Tönend wird hier dem sprichwörtlichen Bild vom Kafkaesken nachgewühlt, dem nichtgreifbaren, unheimlich verhängten, grundlosen Schicksal.
Kafkaeskes im Musiktheater
Die unter dem zweiten Weltkrieg und Faschismus leidende Generation hat das Kafkaeske als eigene, autobiografische Erfahrung im Musiktheater genutzt.
Der von der Gestapo verhaftete Gottfried von Einem, dessen Mutter der Spionage verdächtigt wurde, vertont Kafkas kaum eindeutig deutbares Romanfragment „Der Prozess“.
Hans Werner Henze, den der Vater aufgrund seiner Homosexualität ins KZ überführen will, bringt die Erzählung „Der Landarzt“ als Kammeroper auf die Bühne.
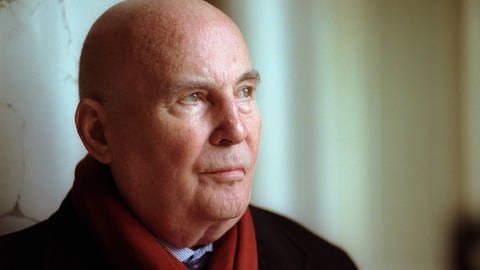
Aribert Reimann, der seinen innig geliebten Bruder bei den Bombenangriffen in Berlin verliert, überführt das Romanfragment „Das Schloss“ ins Musiktheater.
Auch für Roman Haubenstock-Ramati wird das Kafkaeske zum Spiegel des Eigenen. Der aus Lemberg stammende Komponist verliert die Eltern im Holocaust und wird von den sowjetischen Behörden nach dem Hitler-Stalin-Pakt aufgrund seiner Mehrsprachigkeit unter dem Vorwurf der Spionage deportiert.
Er vertont Kafkas fragmentarischen Auswanderroman „Der Verschollene“ als komplex vielschichtige Anti-Oper unter dem vom Herausgeber Max Brod ursprünglich vergebenen Titel „Amerika“.
Salvatore Sciarrino, der Meister der stillen Geräusch- und Sprachmusik, greift zurück auf Kafkas Parabel „Vor dem Gesetz“ zur Darstellung der kafkaesk absurd-korrupten Verhältnisse in der Bürokratie Italiens.
Kurtágs „Kafka-Fragmente“ sind Kafka am nächsten
Kafkas Sprache und der Knappheit seiner Ästhetik des Fragments entspricht wohl am direktesten György Kurtág mit seinem Liederbuch der „Kafka-Fragmente“. Die Sopran-Stimme trägt kurze Sentenzen aus Kafkas Tagebüchern vor. Sie wird nur von einer Geigenstimme flankiert.
Sprache wird in Klang und Geschehen in Geräusch überführt. Es ist ein Komponieren im wörtlichen Sinne des „Componere“, als Zusammenfügung des eigentlich Unvereinbaren in der Kunst Kafkas. Kurtág ist damit vielleicht der Komponist, der der Idee vom Klangbild der Sängerin Josefine und damit Kafkas zwiegespaltenem Verhältnis zur Musik am nächsten kommt.
Mehr zu Franz Kafka
Diskussion Leben im Labyrinth – Wie wurde Franz Kafka zum Weltliteraten?
Der einsame Schriftsteller, der mit Familie und gesundheitlichen Problemen kämpft und die Nächte durchschreibt – Franz Kafka ist zum modernen Mythos geworden. Der in Prag aufgewachsene Autor starb vor 100 Jahren. Seine Kürzestgeschichten genauso wie die berühmten Romane sind, was er von Büchern immer gefordert hat: Die Axt „für das gefrorene Meer in uns“. Seine Helden fremdeln in einer verwalteten Welt, deren Gesetze rätselhaft bleiben. Oder sie gehen darin unter. Biographie oder Werk – was begründet Kafkas Welterfolg? Alexander Wasner diskutiert mit Prof. Dr. Vivian Liska - Literaturwissenschaftlerin, Antwerpen und Jerusalem,
Prof. Dr. Roland Reuß - Herausgeber der historisch-kritischen Ausgabe der Schriften Franz Kafkas, Dr. Yoko Tawada - deutsch-japanische Schriftstellerin
SWR2 Erzählung Franz Kafka: In der Strafkolonie
Die Erzählung "In der Strafkolonie" gehört zu den wenigen Werken, die Kafka ausdrücklich als gültig bezeichnete, während er seinen Freund Max Brod bat, die überwiegende Mehrheit seiner Texte nach seinem Tod zu vernichten. Es ist die Geschichte eines Reisenden, der in einem fernen Land in einer Strafkolonie zu Gast ist und eingeladen wird, einer Exekution beizuwohnen.
Sprecher: Jürgen Holtz
lesenswert Feature Kafka-Kult – Das erstaunliche Nachleben des Franz K.
Kafka ist ein TikTok-Star mit über einer Milliarde Klicks, sein melancholisches Portrait prangt auf T-Shirts, Kaffeetassen und Krawatten. Kafkas Werk wird mittlerweile auf der ganzen Welt adaptiert, in allen Künsten. Nur wenige Autoren besitzen eine solche internationale Wirkung wie er.
Porträt zum 100. Todestag Der Schriftsteller Franz Kafka und die Faszination des Abgründigen
Kafkas Texte faszinieren durch das Abgründige, das in seinen Romanen und Erzählungen über das Individuum in einer immer komplexeren Welt aufscheint.