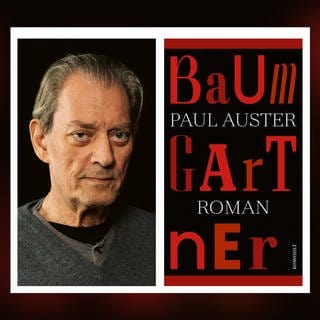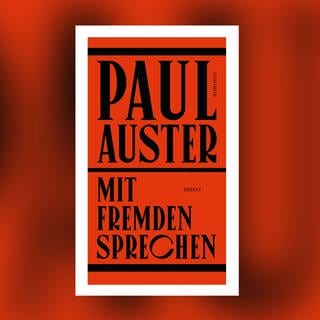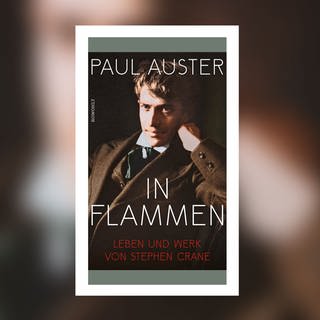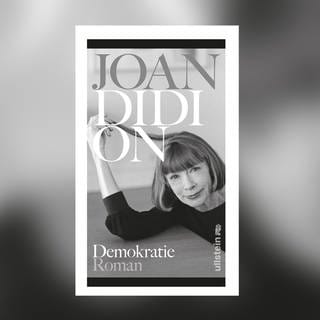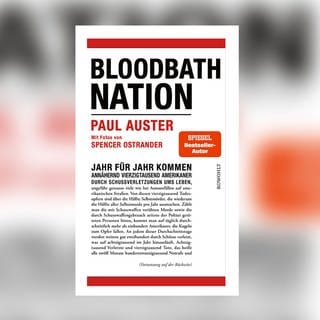Am 26. Oktober 1881 erschossen Wyatt Earp und seine Brüder in ihrer Funktion als Gesetzeshüter drei Banditen, die sich geweigert hatten, für den Aufenthalt in Tombstone ihre Waffen abzugeben. Der Showdown wurde als Schießerei am O.K. Corral zu einem Western-Mythos und sein Schauplatz zur Touristenattraktion.
Eine verwilderte Gegenwart
Doch obwohl solche Ereignisse zu den Urszenen der amerikanischen Waffenkultur zählen, waren sie nichts im Vergleich mit der Gegenwart. In seinem langen Essay „Bloodbath Nation", in dem Paul Auster das Problem des ausufernden Waffenbesitzes in den USA von vielen Seiten beleuchtet, stellt der Autor fest, dass es im Wilden Westen viel weniger blutig zuging als heutzutage:
Der Grund dafür waren strikt durchgesetzte Waffenkontrollvorschriften. In der Wildnis durfte jedermann Waffen tragen, doch sobald man in eine Ortschaft kam, musste man seine Waffen abgeben.
Heute dagegen sind die Kontrollen dürftig, die Feuerkraft hat immens zugenommen und der Blutzoll ist ungeheuer angewachsen. Von den jährlich rund 40.000 Todesfällen durch Schussverletzungen gehen über die Hälfte auf Selbstmord zurück, der andere Teil wird durch Morde und Polizeigewalt verursacht. Die größte Aufmerksamkeit zieht der nihilistische Horror von Amokläufen auf sich, der Menschenleben genauso wie jeden Sinn vernichtet. Das unterstreichen die zahlreichen Schwarzweißfotos im Buch, mit denen Spencer Ostrander die Schauplätze vieler mass shootings als Orte beklemmender Leere dokumentiert. Nicht wenige der Gebäude wurden später abgerissen.
Große Fragen, viele Facetten
Die große Frage, die Auster in diesem Buch sich selbst, seiner Leserschaft und dem ganzen Land stellt, lautet:
Warum geschieht das in Amerika und sonst nirgendwo? Es ist ja nicht so, dass es uns an den Mitteln mangelt, dieser Bedrohung entgegenzutreten, aber aus komplizierten historischen Gründen haben wir den Willen dazu nie aufgebracht.
Auster trägt viel Material zum Waffenproblem der Amerikaner zusammen: Zahlen, historische Informationen, juristische Betrachtungen und zahlreiche Rückblicke auf einige der spektakulärsten Fälle, zum Beispiel das Massaker eines 64-jährigen 2017 in Las Vegas mit 60 Toten und 413 Verletzten.
Er selbst, so bekennt der Autor, habe nie eine Schusswaffe besessen. Seine Großmutter allerdings schon, und die erschoss damit, was in der Familie lange beschwiegen wurde, im Affekt ihren Ehemann.
Kluge Gedanken, doch keine Lösungen in Sicht
Austers Darlegungen zur Sache sind klar und einprägsam, anekdotische Wahrnehmungen, Erinnerungen und Ereignisse werden erzählerisch knapp aber eindringlich vorgestellt. Doch obwohl der Autor nach Kräften versucht, Lösungsperspektiven herbei zu argumentieren, erweist sich die realexistierende Misere als übermächtig. Ein abschließender Rundblick über die von Krisen aller Art zerrissene amerikanische Gesellschaft und Politik verheißt nichts Gutes. Auster schreibt:
In meiner Heimatstadt New York ist die Zahl der mit Schusswaffen begangenen Verbrechen von Mai 2020 bis Mai 2021 um dreiundsiebzig Prozent gestiegen, und die Nachfrage nach Waffen ist so groß, dass die Hersteller kaum noch mitkommen.
Wer dieses Buch liest, erfährt Vieles und Entscheidendes über das uramerikanische Problem mit den Waffen. Allerdings gehört dazu auch eine sehr bittere Erkenntnis: dass nämlich Lösungen zwar denkbar sein mögen, aber der einmütige Wille dazu offenbar nicht herzustellen ist.