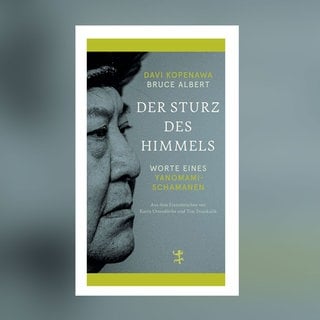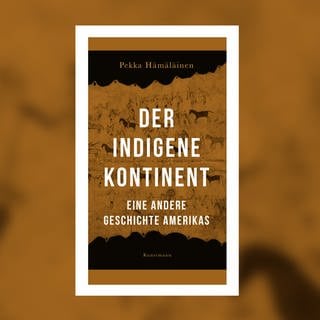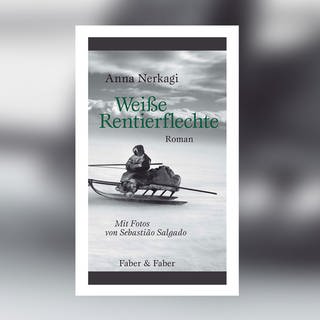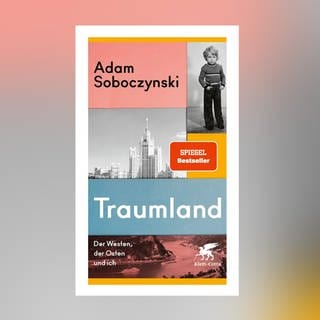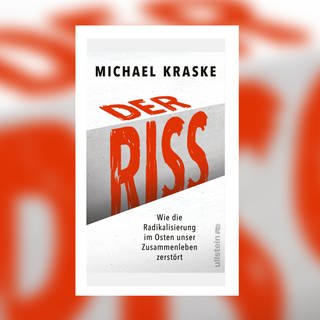Die französische Anthropologin Nastassja Martin geht erhebliche Gefahren ein, um indigene Völker im hohen Norden zu erforschen. Bei den sibirischen Even suchte sie nach schamanistischen Traditionen und fand vor allem sehr reale Probleme.
Der brutale Angriff eines Bären in Kamtschatka brachte die Anthropologin Nastassja Martin 2015 in die internationalen Schlagzeilen: Der Bär riss ihr einen Teil des Unterkiefers weg und zerfleischte ihr Bein. Martin überlebte nur, weil in der Nähe ein russischer Stützpunkt war. So beschrieb sie es 2019 in ihrem gefeierten Buch „An das Wilde glauben“: Wie man ihr in Russland eine Metallplatte anstelle des Unterkiefers einsetzte, wie verständnislos ihre Umgebung auf sie reagierte und wie sie selbst den Angriff verarbeitete. Denn Martin empfand die Bärenattacke auch als eine Art mythische Verschmelzung mit dem wilden Tier, von dem sie in der Nacht vor dem Angriff geträumt hatte.
In ihrem neuen Buch, „Im Osten der Träume“, berichtet die heute 38-Jährige ausführlich von ihrer Zeit bei den Even, einem indigenen sibirischen Volk, das sich nach dem Ende der Sowjetunion neue Erwerbsquellen eröffnen musste.
Ich denke, dass es der Zusammenbruch des sowjetischen Systems ist, der das Unvorstellbare möglich gemacht hat, und dass ich das werde erklären müssen. Ergründen, wie dieses kleine Even-Kollektiv, das durch die Kolonisatoren nacheinander kontaminiert, dezimiert, beraubt und unterjocht und schließlich genau deshalb von der Geschichte vergessen wurde, die systemische Krise zu nutzen wusste, um seine Autonomie zurückzugewinnen.
Polykrisen nach dem Zerfall der Sowjetunion
„Antworten der Even auf die systemischen Krisen“ lautet der Untertitel des Buchs, und gemeint sind die vielen Krisen, die das Leben dieser Gruppe in Kamtschatka beeinflussen. Mit dem Ende des Kommunismus, der Indigene gern in Folkloregruppen präsentierte, lösten sich nämlich auch dort die Kolchosen auf. Die Versorgungslinien brachen zusammen. Auch die kleinen Rentierherden, mit denen die Nomaden früher herumgezogen waren, und aus denen längst staatliche Massenzuchten geworden waren, wurden nach 1991 privatisiert.
Hinzu kommt, dass Kamtschatka über riesige Ressourcen an Öl, Gas, Erzen, Holz und Fisch verfügt, auf die Moskau längst ein Auge geworfen hat. Bereits jetzt bedroht der rücksichtslose Nickelabbau die Siedlungsgebiete der Indigenen. Und auch die – durchaus zwiespältige – Nische, auf die sich die Even nach dem Untergang der Sowjetunion spezialisiert haben, ist bedroht. Aktuell leben sie nämlich vor allem vom Verkauf von Zobelpelzen an reiche Russen. Doch Pelz kommt mehr und mehr aus der Mode, auch in Russland, und die Zobelpopulation rund um den Itscha, den großen Vulkan auf Kamtschatka, ist bereits stark ausgedünnt.
Ein Animismus, in dem Mensch und Tier ihren Platz haben
Mit all dem sieht sich Nastassja Martin konfrontiert, die eigentlich die „animistischen Kosmologien“ der Even erforschen will, ein Denken, das zwischen menschlicher und tierischer Welt kategorial nicht unterscheidet. Dafür schließt sie sich einer Familie an, die nach eigener Aussage „in den Wald zurückgegangen ist“. Den engsten Kontakt hat sie zu der älteren Darja, mit der sie ihre Träume bespricht. Eine Frau, die eigenen Regeln folgt:
In Itscha ist keine Handlung je völlig belanglos, und alles zieht potenziell Folgen nach sich. Insofern würde Darja nie erwähnen, dass jemand oder eine Gruppe von Lebewesen im Verschwinden begriffen ist. Denn diese Eventualität könnte, wenn sie in Worte gefasst – in die Welt gesetzt – würde, durchaus eintreten.
Echtes Interesse an den Antworten der Indigenen
Überzeugend ist Nastassja Martins Buch da, wo sie von den Mythen der Even erzählt, in denen sich menschliche und tierische Welt durchdringen, Rabe, Bär und Lachs eigene Pläne verfolgen und nicht nur menschliche Abbilder sind wie in europäischen Fabeln. Leider kann sich die Autorin aber nicht so recht zwischen Literatur und Forschung entscheiden, was zu störendem Jargon führt. Faszinierend bleibt, wie ernsthaft Martin an den Antworten interessiert ist, die die Indigenen möglicherweise geben können, auch wenn sie längst mit dem Rücken zur Wand stehen.
Mehr zu indigenen Völkern
Buchkritik Davi Kopenawa, Bruce Albert – Der Sturz des Himmels
Er nennt sich „Krieger“ und „Schamane“ – Davi Kopenawa, der zum indigenen Volk der Yanomami gehört, die im Amazonasgebiet leben.
Rezension von Andreas Puff-Trojan
Buchkritik Pekka Hämäläinen – Der indigene Kontinent. Eine andere Geschichte Amerikas
Die indianischen Völker Nordamerikas erscheinen in den gängigen Darstellungen meist nur in einer Opferrolle. Doch inzwischen haben Historiker damit begonnen, ihre wahre Geschichte zu erforschen.
Buchkritik Anna Nerkagi - Weiße Rentierflechte
Aljoschka wartet auf seine Jugendliebe Ilné, wird aber von seiner Mutter mit einer anderen Frau verheiratet. Ein Witwer hadert mit dem Alleinsein. Ein Rentierzüchter muss seine Herde schlachten, um seine Kinder auszuzahlen. Schweigsame Männer und große Gefühle in einem nenzischen Nomadencamp in der sibirischen Tundra.
Rezension von Clemens Hoffmann.
Aus dem Russischen von Rolf Junghanns
Faber & Faber Verlag, 192 Seiten, 22 Euro
ISBN 978-3-86730-197-8
Mehr Literatur zum Thema
Buchkritik Steffen Mau – Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt
Der Soziologe Steffen Mau schaut in seinem Sachbuch auf DDR-Prägungen und kulturelle Mentalitäten. Ein souveränes Buch über Ost und West. Eine Rezension von Holger Heimann.
SWR2 lesenswert Kritik Adam Soboczynski – Traumland. Der Westen, der Osten und ich
In seinem biografischen Essay erzählt Adam Soboczynski erfrischend und unterhaltsam die Migrationsgeschichte seiner Familie, die von Polen nach Deutschland ausgewandert ist. Vor allem aber ist sein Buch eine vehemente Verteidigung des westlichen Liberalismus.
Klett-Cotta Verlag, 170 Seiten, 20 Euro
ISBN 978-3-608-98638
Buchkritik Michael Krask - Der Riss. Wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört
Es braucht nicht weniger als eine Art New Deal Ost. Denn auch wenn es kein Patentrezept gegen die Rechtsdrift gibt: Wir sind dieser destruktiven Entwicklung, die vielerorts das friedliche, respektvolle Zusammenleben zerstört, keineswegs ohnmächtig ausgeliefert. Rezension von Conrad Lay. Ullstein Verlag ISBN 978-3-55020-073-1 352 Seiten 19,99 Euro