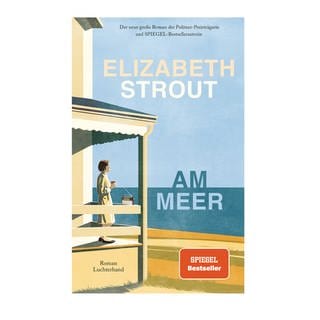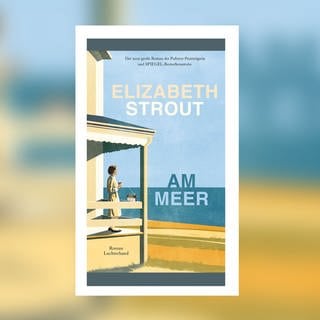Worum geht es in Elizabeth Strouts Roman „Am Meer“?
Das Buch beginnt mit einer der prägendsten Ereignisse der jüngeren Weltgeschichte, nämlich mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Ich-Erzählerin und Schriftstellerin Lucy Barton, die im März 2020 von ihrem Ex-Ehemann William gebeten wird, schnell die Koffer zu packen, New York zu verlassen und vorübergehend in ein einsames Haus am Meer im US-Bundesstaat Maine zu ziehen.
William Gerhardt weiß nämlich, was zu tun ist. Über die damalige Situation sagt Lucy im Rückblick:
Ich hatte es so wenig kommen sehen wie die meisten. Aber William ist Naturwissenschaftler, er sah es kommen.
Diese so bodenständige wie nachdenkliche Erzählhaltung prägt den Romanstoff, der nicht nur von den verheerenden Folgen so mancher Virus-Infektion, sondern eben auch von den Auswirkungen von Lockdown und Isolierung auf fragile Familienverhältnisse handelt.
Die Zerrissenheit der USA: Gibt es eine Handlung?
Das ist der literarische Clou des Romans, der keinen künstlich inszenierten Plot braucht. Die Dramen ereignen sich in jeder Wohnung, in jedem Haus. Die Schwester der Erzählerin tritt in der Pandemie zum Beispiel einer christlichen Sekte bei, was das ohnehin angespannte Verhältnis der beiden noch verschärft. Der Bruder wird im Verlauf des Romans sterben, ohne dass Lucy und er sich noch einmal sehen konnten.
Leserinnen und Leser von Elizabeth Strout kennen die Figuren dieses Buchs aus vorangegangenen Werken. Doch auch wer die Vorgeschichten nicht gelesen hat, begreift schnell, dass Strouts Charaktere keine Kopfgeburten sind.
Neben den so plastisch wie lakonisch beschriebenen Familienkrisen berichtet Lucy Barton auch von der Zerrissenheit ihres Landes, von den politischen Verwerfungen unter Donald Trump, den tödlichen Angriff eines Polizeibeamten auf George Floyd und den alltäglichen Hass auf den Straßen. Auch in Maine werden die zugereisten New Yorker auf der Straße als Fremde beschimpft und aufgefordert, wieder nach Hause zu fahren.
Plaudern gegen die Zumutungen
Gegen all diese Zumutungen setzt Elizabeth Strout ihre Protagonistin Lucy Barton, die ohne Unterlass zu reden scheint, am Telefon und vor der Tür mit Nachbarn, mit ihrem Mann und vor allem auch mit sich – und dieser Redefluss ist ernst und heiter, beruhigend und aufwühlend.
Hier wird nichts beschönigt, hier kommen alle Widersprüche dieser Epoche auf den Romantisch – und genau darin besteht die Stärke dieses Lockdown-Romans, der eine klassische Handlung nicht nötig hat.
Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Pandemie-Romanen, was zeichnet dieses Buch von Elizabeth Strout literarisch aus?
Wenn von der Pandemie die Rede ist, dann wird es schnell sehr emotional. Die in jedem Fall krassen Erfahrungen von Krankheit und auch Einsamkeit sind offensichtlich noch nicht überwunden. Weder in Europa noch in den USA.
So ist es auch kein Wunder, dass seit Ende der Pandemie schon eine ganze Reihe von Romanen erschienen sind, die sich mit dieser Zeit befassen. Zumal der Seuchen-Roman kein neues Genre ist; man denke nur an den Klassiker „Die Pest“ von Albert Camus, der in den Lockdown-Zeiten wieder häufiger gelesen wurde.
Die jüngeren Pandemieromane, die ich gelesen habe, scheitern leider entweder an einer seltsamen Ereignislosigkeit, wie etwa „Die Verletzlichen“ von Sigrid Nunez. Oder es handelt sich um unverstellte Wutprosa, wie etwa bei Marlene Streeruwitz und ihrem Pandemie-Roman „Tage im Mai“, in dem dann vieles miteinander vermengt wird, nämlich politische Tiraden und wilde Verschwörungstheorien mit der ausufernden Schilderung von Panikattacken und Schreibblockaden.
Eine Ich-Erzählerin, die emphatisch, reflektiert und selbstkritisch ist
Dass es im Zustand des temporären Eingesperrtseins nicht leicht ist, Fiktion zu produzieren, altbekannte Schreibroutinen abzurufen, davon berichtet auch Strouts Alter-Ego Lucy Barton. Doch hier, in Strouts Roman „Am Meer“, wird alles in einem vermeintlich leichten Plauderton erzählt, der mit der eigenen Unzulänglichkeit spielt.
Statt zu dozieren, statt Wut in die Welt zu schreien, wie das etwa Streeruwitz in österreichischer Lamento-Tradition macht, setzt Strout auf eine gebrochene Umgangssprache, die davon zeugt, dass sich jemand in einer neuen Welt zurechtfinden muss.
Die Ich-Erzählerin ist empathisch, reflektiert und selbstkritisch - darin besteht die literarische Größe dieses Pandemie-Romans, der Maßstäbe setzt. Es kommt, wie so oft in gelungener Literatur, vor allem auf die Erzählperspektive an.