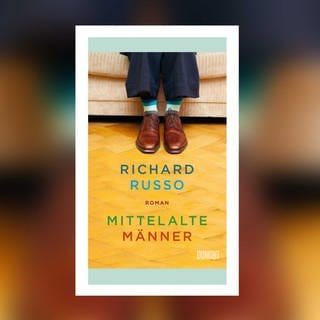Auch toxische Männlichkeit kann als Symptom einer Identitätskrise gelesen werden. Der Schweizer Psychologe Markus Theunert stellt Erkenntnisse der Geschlechterforschung und Erfahrungen aus der Männerarbeit mit viel Sachverstand und Humor dar.
So wichtig das Erkämpfen der Frauenrechte seit über hundert Jahren ist, so notwendig sind die Gender-Debatten der vergangenen Jahre. Besonders jetzt, wo durch starke Migration aus anderen Sozialstrukturen unser gesellschaftlicher Konsens über die Gleichstellung der Geschlechter herausgefordert wird.
Dabei erweist es sich als wenig hilfreich, wenn pauschal ein Täter-Opfer-Klischee bemüht wird: hier die unterdrückte Frau, dort der privilegierte Mann. Eine vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebene Studie aus dem Jahr 2017 zeigte, dass 80% der Männer eine Gleichstellungspolitik nicht nur befürworten, sondern sogar für partnerschaftlich, wirtschaftlich und gesellschaftlich notwendig halten.
Wie sie aber auszusehen hat, ist strittig und ihre Umsetzung daher schleppend. Um Gründe für dieses Dilemma zu finden, muss auf gesellschaftliche Strukturen, auf Stereotypen und Rollenbilder geschaut werden. So beschreibt Markus Theunert das Mannsein heute in seinem jüngsten Buch als ein „Angespanntsein zwischen Größenfantasie und Versagensangst“.
Erwartungshaltungen ans Mannsein
Der profilierte, gleichwohl nicht unumstrittene Psychologe und Vertreter einer geschlechterreflektierten Männerpolitik weiß aus seiner praktischen Arbeit mit Jungen, Männern und Vätern, dass der kulturgeschichtliche Imperativ, wie ein Mann zu sein habe, eine Erwartungshaltung zementiert hat, die der Einzelne nur schwer aufbrechen kann.
Die bipolare Definition von Weiblichem und Männlichem führt für den Mann häufig zur Verleugnung innerer Bedürfnisse, auch zu einer Selbst- und Fremdausbeutung, die nur zu gut die Mechanismen des westlichen Kapitalismus bedient. Dessen Hauptakteur ist der weiße cis-Mann, also derjenige, dessen Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt.
Die Rolle des weißen cis-Mannes ist strukturell vorgegeben
Die Rolle des patriarchalen, weißen cis-Mannes ist keine frei gewählte, sondern – auch – eine strukturell vorgegebene, wie der Schweizer in seinen viel beachteten sozialpsychologischen Fachpublikationen dargelegt hat.
Unter dem Titel Jungs, wir schaffen das richtet er nun geradezu provokativ einen Appell zur kritischen Selbstreflexion und Achtsamkeit an „die große Gruppe der „ganz normalen“ Männer: weiße Haut, westeuropäische Wurzeln, christliche Werte, heterosexuelles Begehren, unauffälliges Äußeres, robuste Performance – und eigentlich gern „Mann“.
Ratgeber zu Selbstbefragung und Achtsamkeit
Der Autor gibt dem vielgescholtenen weißen cis-Mann eine analytische Bestandsaufnahme im Kontext der herrschenden Männlichkeitsideologie an die Hand, und er versteht sich als Ratgeber zum Innehalten und praktischen Üben in Selbstbefragung und Achtsamkeit. Dabei zeichnet er nicht ein Bild des ‚neuen Mannes‘, sondern er zeigt auf, wie der Einzelne seinen persönlichen Weg als Mann findet.
Jenseits toxischer Männlichkeit, die auf Stärke, Gewalt, Status, Risikoverhalten und Weiblichkeitsabwehr ausgerichtet ist und sowohl nach außen als auch auf den Mann selbst vergiftend wirkt. Das ist eine überzeugende Konzeption und eine gelungene Mischung, – fundiert in der Sache, offen im breiten Blickwinkel auf das Fluide der Geschlechter und einfühlsam im Ton. Ein wegweisendes Buch für eine große Gruppe verunsicherter, gerade auch jüngerer Männer ohne taugliche Vorbilder in vorangegangenen Generationen.