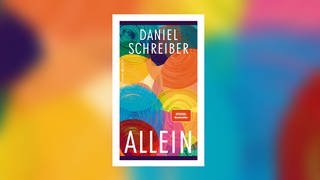Februar in Venedig. Daniel Schreiber ist in die Stadt gekommen in der Hoffnung, hier eine neue Lebensphase zu beginnen. Seit dem Tod seines Vaters hat er sich in Arbeit geflüchtet und sich von seinem sozialen Umfeld zurückgezogen. Er weiß, dass sein Gefühl der Taubheit verdrängte Trauer ist; in Venedig will er endlich lernen, zu trauern.
In diesem stillen und nachdenklichen Buch begleiten wir Daniel Schreiber einen Tag lang durch die Stadt. Er schaut seine Lieblingsbilder in der Accademia an, besucht die Toteninsel San Michele, erinnert sich an seine Kindheit im ländlichen Mecklenburg, denkt über die Verluste seines Lebens nach – und stellt fest, dass es ihm schwerfällt, den lange ignorierten Schmerz zu fühlen.
Was gilt in unserer Gesellschaft als Verlust?
„Trauer“, schreibt er, „kann viele Jahre auf uns warten, versteckt in irgendeiner Nische unseres Ichs, ohne dass wir davon wissen. Erst recht die verdrängten und nicht von uns bearbeiteten Verluste summieren sich und können uns unvermittelt mit großer Wucht treffen.“ Trauer werde oft nicht erkannt, weil es einen sozialen Konsens darüber gibt, welche Verluste überhaupt als Verluste verstanden werden. Diese „Betrauerbarkeit“ bestimme, wie und ob wir unserer Trauer Ausdruck verleihen können.
Daniel Schreiber ist bekannt für seine enorme Belesenheit, und wieder hat er eine Fülle von wissenschaftlichen und literarischen Zitaten zum Thema Verlust und Trauer zusammengetragen, die allein schon die Lektüre des Buches lohnen. Die Ozeanografin Summer Praetorius zum Beispiel erklärt anhand der Ökosysteme, dass sich alle Lebensabläufe verlangsamen, kurz bevor der Kollaps eintritt.
An diesem Zeitpunkt verlieren die Systeme ihre Resilienz, ihre Fähigkeit, nach Störungen zu einem neuen Gleichgewicht zu finden. Daniel Schreiber fragt sich, ob nicht nur er persönlich, sondern auch unsere Gesellschaft bereits an die Grenzen der Resilienz gelangt ist.
Fehlende Strategien der Resilienz
In seinem Leben sind nicht nur Menschen gestorben, er hat auch angesichts der Weltereignisse Hoffnung und Zuversicht verloren. Wir hätten, schreibt er, schon viel früher merken müssen, dass sich etwas verschiebt. Der voranschreitende Klimawandel, die Finanzkrise im Jahr 2008, die Fremdenfeindlichkeit und Homophobie haben ihm die Hoffnung auf eine freundliche Zukunft genommen.
Daniel Schreiber ist 1977 geboren; seine Ratlosigkeit ist auch ein Ausdruck des Lebensgefühls einer Generation, die in vermeintlicher Sicherheit und Stabilität aufgewachsen ist und, anders als die Nachkriegsgeneration ihrer Eltern, keine Strategien für den Umgang mit Verlusten entwickelt hat.
Ein heiteres Dennoch im Angesicht der Krisen
Wie in allen Büchern von Daniel Schreiber ist hier ein suchendes Ich beobachtend und fragend unterwegs. Der konkrete Gang durch die Stadt als Rahmenhandlung wirkt deshalb anfangs etwas konstruiert, funktioniert im Verlauf des Buches aber erstaunlich gut, und das liegt an Venedig. Die Stadt wird zum Ausdruck all jener Gefühle, für die der Autor keine Sprache findet.
Der Nebel aus der Lagune spiegelt das Grau, das er „die wahre Farbe der Trauer“ nennt, das Gewirr der Gassen und Brücken seine innere Orientierungslosigkeit. Natürlich weiß er, dass Nachdenken über Trauer nicht dasselbe ist wie Trauern, und beginnt sich zu fragen, ob es nicht an der Zeit sei, „auf Augenhöhe“ mit seinen Gespenstern zu leben.
Erstaunt stellt er fest, dass die Venezianer dem drohenden Untergang ihrer Stadt zum Trotz weiterhin ihre köstlichen Pasticcini backen und Karneval feiern. Der Schluss des Buches deutet an, dass dieses gelebte heitere Dennoch letzten Endes das Geschenk ist, das Daniel Schreiber aus Venedig mit nach Hause genommen hat.