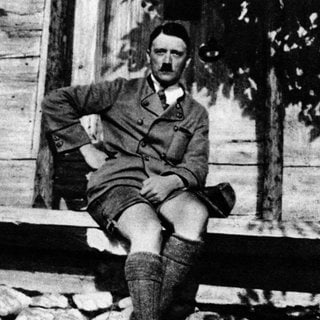Die Angst vor dem verwöhnten Kind ist eine typisch deutsche Angst und noch immer weit verbreitet, erklärt der renommierte Bindungsforscher Karl Heinz Brisch, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Viele Eltern hätten auch heute noch immer das Gefühl, sie müssten härter durchgreifen, um keine potentiellen Tyrannen heranzuziehen.
Das habe mir ja schließlich auch nicht geschadet - ein Irrglaube mit fatalen Folgen bis in die heutige Generation. Die Ursachen für diese Erziehungsmuster sehen Bindungsforscher und -forscherinnen unter anderem in der Pädagogik während des Nationalsozialismus.
NS-Erziehung: ein unterschätztes Problem
Denn um eine Generation aus Mitläufern und Soldaten heranzuziehen, forderte das NS-Regime damals von Müttern, die Bedürfnisse ihrer Kleinkinder gezielt zu ignorieren. Sie mit Liebesentzug und auch Gewalt zu bestrafen. In älteren Ratgebern finden sich die brutalen Erziehungsideologien dieser Zeit wieder.

Auch das schreiende und widerstrebende Kind muss tun, was die Mutter für nötig hält, und wird, falls es sich weiterhin ungezogen aufführt, gewissermaßen, kaltgestellt‘, in einen Raum gebracht, wo es allein sein kann, und so lange nicht beachtet, bis es sein Verhalten ändert. Man glaubt gar nicht, wie früh und wie rasch ein Kind solches Vorgehen begreift.
Dieses Zitat stammt aus dem Buch "Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“, das 1934 von der Lungenfachärztin und überzeugten Nationalsozialistin Johanna Haarer geschrieben wurde. Hitler persönlich soll den Erziehungsratgeber empfohlen haben. Haarers Buch wurde zum Besteller während der NS-Zeit und in abgemilderter Form sogar noch bis 1987 verlegt. Der Geist der NS-Erziehung habe Generationen von Müttern geprägt:
Unsere Mütter, Großmütter vor allen Dingen, hatten alle das Buch im Regal stehen und bekamen das zur Geburt ihrer Kinder geschenkt. Auch noch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Karl Heinz Brisch warnt schon lange vor den unterschätzten Folgen dieser NS-Pädagogik auf die heutige Gesellschaft. Viele Betroffene, die für diese Recherche interviewt wurden, erzählen von Schwierigkeiten, Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen, finden keinen Zugang zu ihren Gefühlen und entwickelten Krankheiten wie Depressionen oder Alkoholsucht.
Angst statt Urvertrauen
Kinder, die nicht feinfühlig oder auch gewaltsam behandelt wurden, können ihr ganzes Leben unter diesen zerrütteten Eltern-Kind-Beziehungen leiden. Sie gelten als "unsicher gebunden":
Statt Urvertrauen haben diese Menschen Urangst innerlich an Bord. Und das prägt natürlich das ganze weitere Leben, wie sie dann in Partnerschaften mit ihren Kindern, in Beziehungen mit anderen Menschen umgehen und ob sie sich da anvertrauen können oder da eine Grundangst ist.
Johanna Haarer gilt heute als Inbegriff für die NS-Erziehungsideologie. Sie wurde sicherlich gefördert im Nationalsozialismus, erklärt Sonja Levsen, Professorin für Neuere Geschichte an der Universität Tier, warum ausgerechnet Haarer derart bekannt wurde.
Doch neu war das nicht, was Haarer da schrieb: Sie knüpfte mit ihrem Buch an bereits bestehende Erziehungsmodelle an. Eine bindungsarme Pädagogik, die auch gerne als schwarze Pädagogik bezeichnet wird, hatte hier wie auch in anderen Ländern zum Leid vieler Kinder eine lange Tradition.
Versagt auch der Schnuller, dann, liebe Mutter, werde hart! Fange nur ja nicht an, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf dem Schoß zu halten, es gar zu stillen. Das Kind begreift unglaublich rasch, daß es nur zu schreien braucht, um eine mitleidige Seele herbeizurufen […].

Transgenerationale Weitergabe
In manchen Familien wirkt das Kindheitstrauma über Generationen fort. Die psychologische Forschung spricht in solchen Fällen von transgenerationaler Weitergabe; sind die Erlebnisse besonders schlimm von transgenerationalem Trauma. Verhaltensmuster und Erfahrungen werden von einer Generation an die nächste weitergegeben. Insbesondere dann, wenn diese nicht verarbeitet wurden, ist es schwierig, bestimmte Muster aufzubrechen, sagt Professorin Luise Reddemann, Psychoanalytikerin und Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin.
Wenn man sich Familiengeschichten anschaut, die Geschichte der Eltern und Großeltern, dann sieht man eigentlich immer: ja, die haben auch viel Gewalt erlebt. Das ist nicht einfach aus heiterem Himmel aus denen herausgekommen, die Gewalt, die sie ihren Kindern antun oder angetan haben.
Das sind häufig auch Erfahrungen, die sehr früh passiert sind, wie beispielsweise das Schreienlassen, und die dann tief in unseren emotional neuronalen Netzwerken verankert sind und auch durch Psychotherapie nicht so einfach zu erreichen sind.
Eltern, die eine entsprechende Vorgeschichte aus ihrer Kindheit mitbringen, fällt es dann oftmals schwerer, feinfühlig auf ihre Kinder zu reagieren und gute Bindungen zu ihnen aufzubauen, erklärt Professor Brisch, der unter anderem aus diesem Grund SAFE, eine Art Elternführerschein ins Leben gerufen hat, in dem er Eltern erklärt, wie sie von Geburt eine gute Bindung zu ihrem Kind aufbauen können.

Tradierte Erziehungsmuster sind hartnäckig
Wie genau Traumata von Generation zu Generation weitergegeben werden, ist noch unklar. Die Längsschnittstudie des Universitätsklinikum Ulm "TRANS-GEN" zu Einflüssen mütterlicher Kindheitserfahrungen auf ihre Kinder beobachtet seit 2013 Familien. Sie konnte zum Beispiel auch belegen: etwa 10 bis 30 Prozent der Mütter und Väter geben ihre eigenen Erfahrungen an die Kinder weiter. Aber: viele tun es eben auch nicht.
Und hier kommt die große Hoffnung: Ein Großteil schafft es, aus alten Mustern auszubrechen, unabhängig davon, wie lieblos oder gewaltvoll die Kindheitserfahrungen waren. Woher diese Widerstandskraft kommt, interessiert derzeit viele Forschende. Vieles ist noch unerforscht.
Was sich aber auch hier abzeichnet: Es kommt auch hier sehr darauf an, welche Möglichkeiten die Menschen hatten, ihre Kindheitserfahrungen zu verarbeiten.
Es braucht ein Bewusstsein für das eigene Leiden und eine Entscheidung: Das will ich meinen Kindern nicht antun. Und im nächsten Schritt muss ich mir überlegen: wie kann ich das hinkriegen? Das muss man sich erarbeiten, wie auch immer. Am besten auch durch Therapie. Dann kann das schon funktionieren, den Kreislauf zu durchbrechen.
Reddemann hat den Eindruck, dass heute immerhin im Zuge einer bedürfnisorientierten Erziehung viele Eltern liebevoller mit ihren Kindern umgehen als früher. Diese Idee, dass kleine Kinder Tyrannen sind, ist allerdings nicht ganz verschwunden.
Es gibt schon wieder Erziehungsratgeber, die das deutlicher vertreten: Jedes Kind kann schlafen lernen zum Beispiel, kritisiert Reddemann. Ein Buch, das Kinder darauf konditionieren soll, alleine einzuschlafen. Auch Karl Heinz Brisch betont, wie tief verankert dieses Erbe dieser Erziehung immer noch in uns ist, sieht aber dennoch auch Hoffnung:
"Je mehr wir darüber sprechen, wie positiv die Effekte einer liebevollen Erziehung sind, umso mehr Eltern werden zumindest mal nachdenklich. Und wenn Eltern, dann spüren ich kriegs überhaupt nicht auf die Reihe, ich werde selber so gestresst durch meine Kinder, und sich dann in Beratungsstellen Unterstützung holen und eine Idee bekommen, wie sie es anders machen könnten, um auch ihre eigenen Geschichten zu verarbeiten, dann sind wir schon auf dem richtigen Weg. Das gibt dann Hoffnung, dass sich über die Zeit, eine Gesellschaft verändern könnte und wir irgendwann friedvoller mit unseren Kindern, miteinander umgehen."