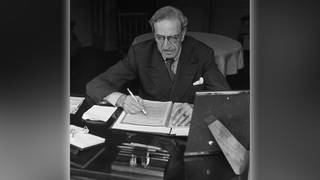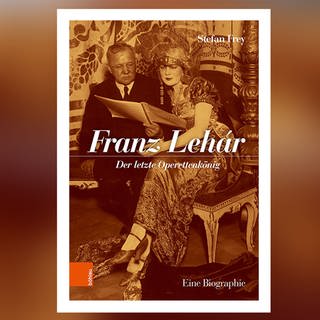- Ralph Benatzky – Die „Rößl“-Welle verpasst
- Emmerich Kálmán – „Ich bin eine lächerliche Figur“
- Paul Abraham – Der Dirgent auf der Madison Avenue
Eine neue Operette am Ende des Kaiserreichs
Spricht man von der „Silbernen Operettenära“, meint man damit weithin die Operette in den Jahren zwischen 1900 und 1940. Der Begriff hat sich in Abgrenzung zu den angeblich goldenen Jahren der Wiener Operette ab 1860 durchgesetzt, den Zeiten von Johann Strauss, Franz von Suppè und Carl Millöcker.
Auch wenn die Einteilung erst in den 1950er-Jahren vollzogen wurde: Das Dritte Reich schwingt mit bei der Wertung. Die silberne Operettenära, das ist nämlich die Ära der jüdischen Operettenautoren.

Um die Jahrhundertwende drängt eine neue Generation auf die Operettenbühnen. Während das Kaiserreich kurz vor dem Kollaps steht, amüsiert sich Wien zu Lehárs „Lustiger Witwe“ und Kálmáns „Csárdásfürstin“. Die Operette ist auch international populär, sogar am Broadway werden mitunter englische Bearbeitungen der österreichischen Erfolgsstücke gespielt.
Musicbanda Franui lassen mit „Hotel Savoy“ in Stuttgart die jüdische Operette wieder aufleben
Goebbels will die Operette ideologisch bereinigen
Nach dem Weltkrieg finden Jazz- und Foxtrott-Klänge ihren Weg in die Operette, ebenso das in Amerika so beliebte Revuetheater, das vor allem im feierwütigen Berlin der „Roaring Twenties“ sein Publikum findet.
Den Nationalsozialisten ist der Jazz, den sie als „Negermusik“ verunglimpfen, ein Dorn im Auge, genauso die Satire, mit der Operettenautoren deutsche Volkstümelei aufs Korn nehmen. Kein Zufall: Viele Komponisten, Librettisten und Regisseure, aber auch Sängerinnen und Sänger sind entweder selbst jüdisch oder mit Jüdinnen und Juden verheiratet.
Mit der Machtergreifung 1933 beginnt Reichspropagandaminister Goebbels damit, die Operette auf Parteikurs zu bringen und ideologisch zu bereinigen. Jüdische Komponisten werden verboten, Librettisten unterschlagen, freie Theater geschlossen. Was propagandistisch akzeptabel ist, landet auf den Spielplänen der großen Opernhäuser. Vielen Operettenmachern bleibt nur der Weg in die Diaspora.
Ralph Benatzky – Die „Rößl“-Welle verpasst
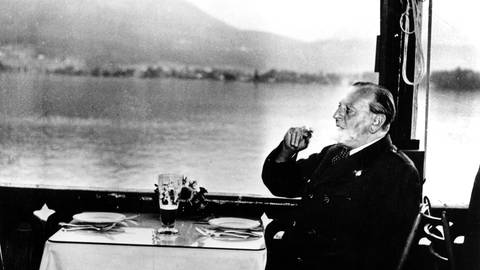
1930 ist Ralph Benatzky auf dem Höhepunkt seines Erfolgs: „Im weißen Rößl“ feiert im Großen Schauspielhaus in Berlin seine umfeierte Premiere. Große Kabarett- und Filmstars spielen in der Produktion, wenig später wird das Stück als „L’Auberge du cheval blanc“ bzw. „The White Horse Inn“ auch zum internationalen Hit.
Schlager habe er eigentlich nie schreiben wollen, betont der aus Mähren stammende Benatzky immer wieder. Doch das Komponieren fällt ihm leicht:
Ich schüttle täglich anderthalb bis zwei Kilogramm Chansons ‚aus dem Ärmel‘, je nach Witterung und Jahreszeit.
Den Nationalsozialisten steht Benatzky schon vor der Machtergreifung kritisch gegenüber. 1924 mokiert er sich in seinem Tagebuch über die „Urgermanen mit Wampe und Nackenspeck“. Schließlich verlässt er Berlin 1932 mit seiner jüdischen Frau Melanie und siedelt in die Schweiz über.
Benatzkys Stücke landen in Deutschland auf der Liste für „entartete Kunst“. Er ist zwar selbst nicht jüdisch, aber seine Mitautoren – allen voran Erik Charell, der das „Rößl“ in Berlin, Paris, London und New York inszeniert hatte.
Das WDR Funkhausorchester spielt ein Medley aus Benatzkys „Im weißen Rößl“
Mit dem Wegbruch des deutschen Marktes wendet der Komponist seine Aufmerksamkeit nach Amerika. 1938 verlässt er die Schweiz in Richtung Hollywood. Doch die dortigen Angebote sagen ihm nicht zu. Die Erfolgswelle des „weißen Rößls“ ist bereits abgeebbt und viele emigrierte Komponisten suchen Arbeit.
Einen Vertrag mit MGM lässt Benatzky platzen. Die „Lümmelhaftigkeit“ und „Oberflächlichkeit“ der Amerikaner missfällt ihm. Benatzky lebt von seinem Ersparten, arbeitet als Dirigent fürs Radio und übersetzt Stücke ins Deutsche, darunter Gershwins „Porgy & Bess“.
Nach dem Krieg zieht es Benatzky wieder nach Zürich. Er komponiert für den Film, aber nicht mehr für die Bühne. 1957 stirbt er, seine letzte Ruhe findet er auf eigenen Wunsch in St. Wolfgang im Salzkammergut, dem Handlungsort seines größten Erfolgs.
Benatzkys sehnsuchtsvolles „Wiener Lied in New York“, gesungen von Daniela Ziegler
Emmerich Kálmán – „Ich bin eine lächerliche Figur“

Weniger der Jazz als vielmehr der ungarische Csárdás steht im Mittelpunkt der Operetten von Emmerich Kálmán. Der Komponist, der 1882 im ungarischen Siófok geboren wird, siedelt 1908 nach ersten Erfolgen in Budapest nach Wien über.
Hier wird er für seine Operetten frenetisch gefeiert. „Die Csárdásfürstin“ (1915), „Gräfin Mariza“ (1924) und „Die Zirkusprinzessin“ (1925) treffen den Zahn der Zeit. „Verdi, Richard Wagner, Puccini hatten Misserfolge“, schreibt etwa die Wiener Neue Freie Presse, „bei Kálmán ist das ganz ausgeschlossen.“
Anna Netrebko singt „Heia, in den Bergen“ aus „Die Csárdásfürstin“
Als Jude erhält Kálmán kurz nach der Machtergreifung der Nazis in Deutschland Aufführungsverbot. Trotzdem fühlt er sich in Wien weiter sicher. Erst nach dem „Anschluss“ Österreichs flieht Kálmán über Budapest und Paris nach New York.
„Meine Musik kauft niemand (…). Ich bin eine lächerliche Figur.“
Doch wie Benatzky hat Kálmán dort sein Zeitfenster verpasst: Seine Operetten will im schnelllebigen Amerika niemand mehr hören. Für viele kleinere Aufträge ist der einstige Operettenkönig zu stolz, seinen Abstieg in die Bedeutungslosigkeit kann er nicht akzeptieren. Seine Frau Vera verlässt ihn schließlich für einen Parfümverkäufer, kehrt später aber wieder zu ihm zurück.
Fritz Wunderlich singt „Kleiner Cowboy“ aus Kálmáns letzter Operette „Arizona Lady“
Kálmán versucht sich schließlich an Musicals und kann den amerikanischen Textautor Lorenz Hart zur Zusammenarbeit bewegen. Dieser stirbt vor der Vollendung von „Miss Underground“. Kálmán nutzt die Songs später für „Marinka“, ein Stück über die Mayerling-Affäre um den österreichischen Kronprinzen Rudolf.
1949 kehrt Kálmán nach Europa zurück und lässt sich schließlich in Paris nieder, wo er 1953 stirbt. Seine letzte Operette „Arizona Lady“ wird von seinem Sohn Charles vollendet und 1954 im Radio uraufgeführt.
Paul Abraham – Der Dirgent auf der Madison Avenue

Mit „Ball im Savoy“ feiert Paul Abraham noch am 23. Dezember 1932, wenige Wochen vor der Machtergreifung Hitlers, im Berliner Schauspielhaus eine rauschende Premiere.
Seine ersten Erfolge hat der gebürtige Ungar als Komponist klassischer Musik in den 1910er-Jahren, dann versucht sich Abraham allerdings erfolglos an Bankgeschäften und muss kurzzeitig ins Gefängnis. 1927 wird er Kapellmeister am Budapester Operettentheater und beginnt, selbst Operetten zu komponieren.
Jonas Kaufmann singt „Diwanpüppchen“ aus „Die Blume von Hawaii“
Abrahams Operettenkarriere ist kurz, aber intensiv: 1930 wird „Viktoria und ihr Husar“ ein Welterfolg, ein Jahr später folgt mit „Die Blume von Hawaii“ das erfolgreichste Stück der Weimarer Republik. Gleichzeitig schreibt er Musik für zahlreiche Filme.
Nachdem Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wird, landen die Stücke von Abraham schnell auf der Liste für „entartete Musik“ und sein Vermögen wird beschlagnahmt. Abraham arbeitet zunächst noch in Österreich und Ungarn, flieht aber schließlich über Paris und Kuba in die USA.
Auch ihm gelingt es nicht, in Amerika Fuß zu fassen. Dass Interesse an seinen jazzlastigen Revuen ist im Mutterland des Jazz nur verhalten.
Katharine Mehrling singt „Es ist so schön am Abend bummeln zu geh'n“ aus „Ball im Savoy“
Abraham leidet in New York wie viele seiner Leidensgenossen unter starken Depressionen. 1946 wird er in die Nervenheilanstalt eingewiesen. Er hatte in seinem zerschlissenen Anzug wahnhaft versucht, den Verkehr auf der Madison Avenue zu dirigieren. Bei der anschließenden Untersuchung wird eine Psychose aufgrund einer verschleppten Syphiliserkrankung diagnostiziert. Erholen wird er sich davon nie mehr.
1956 sammeln Freunde in Deutschland für Paul Abraham und holen den ehemaligen Star der Operettenwelt nach Hamburg. Er lebt bis zu seinem Tod im Glauben, in New York zu sein und eine große Premiere für den Broadway vorzubereiten. 1960 stirbt er im Alter von 67 Jahren.
Musikstunde Oscar Straus – Musikalischer Weltbürger (1-5)
Mit Andreas Maurer
Mit Operetten will Deutschland vergessen
Es gibt unzählige weitere Künstlerschicksale, die in den zwölf Jahren unter der Herrschaft der Nazis vernichtet wurden. Man denke an den Tenor Richard Tauber, der nach Großbritannien floh, oder Fritz Löhner-Beda, der das Libretto zu einigen der größten Erfolge von Franz Lehár schrieb, darunter „Das Land des Lächelns“ und „Giuditta“.

Während Lehár als einer der Lieblingskomponisten des Führers gefeiert wurde, wurde Löhner-Beda 1942 nach Stationen in Dachau und Buchenwald im Konzentrationslager Auschwitz erschlagen. Seinen Namen hatte man von Lehárs Werken entfernt.
Nach 1945 flüchtet sich Deutschland vor der Kriegsschuld in die heilen Welten der Heimatfilme und Operettenmelodien, gespielt und gesungen von einstigen System-Kollaborateuren wie Marika Rökk und Johannes Heesters. Das Interesse bleibt jedoch rein museal: Was von der Operette bleibt, ist ein Schaukasten in eine heilere und leichtere Vergangenheit.