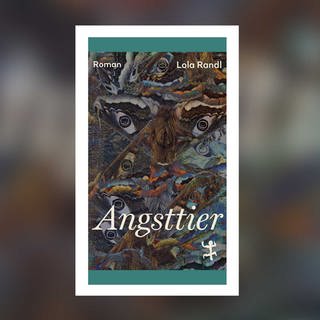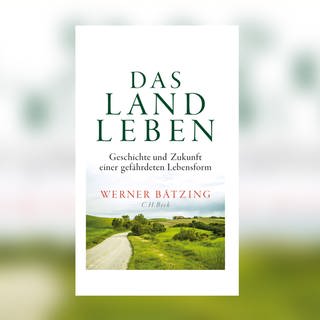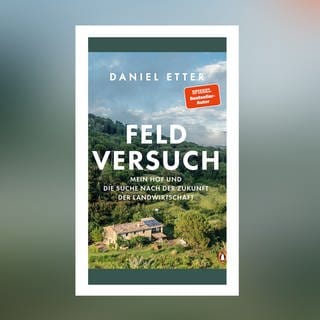Der Philosoph Björn Vedder ist aufs Land gezogen und versprach sich Idylle. Aber hinter den beschaulichen Fassaden der Dorf- und Landhäuser geht es oft wenig idyllisch zu: eine krude Mischung aus Vermögens- und Familienwerten, Statuskonsum, Anpassungsdruck und sozialer Kontrolle. Eine kleine Verhaltensabweichung genügt, und man wird von der Mehrheit gejagt, gehänselt, geächtet, beschämt. Eine provokante Entzauberung des Landlebens.
Vor einigen Jahren hat der Autor und Publizist Björn Vedder das gemacht, wovon viele Städter träumen. Er ist mit seiner Familie aus München hinaus gezogen in ein Dorf am Ammersee.
Seine gar nicht so ausgezeichneten Erfahrungen haben ihn nun dazu gebracht, das erzählende Sachbuch „Das Befinden auf dem Lande“ zu schreiben.
Befürchtet Vedder, dass er nach Veröffentlichung des Buches aus seinem Dorf wegziehen muss?
Björn Vedder:
„Nee, es haben schon einige gelesen und die finden es alle gut und sagen, das seh ich genauso.“
Das Dorf kommt nicht gut weg
Im Buch kommt das Dorf nicht gut weg. Das Landleben tut eigentlich niemandem wirklich gut, das zeigt Vedder an vielen Beispielen.
Unter anderem berichtet er davon, wie es ihm erging, als einem von Zuhause aus arbeitenden Mann, der sich tagsüber um die Kinder kümmert, während seine Frau einer abhängigen Berufstätigkeit außer Haus nachgeht. Nicht gut kam das in seinem Dorf an, wo sich, wie er schreibt, nicht nur das traditionelle Familienbild noch gut hält, sondern es überhaupt ein ausgeprägtes und allgemein gültiges Verständnis gibt, für das, was man tut und das, was man lässt.
„Das Merkmal von Landleben ist, dass es da eine Form von Gemeinschaft gibt, die eine Art von kollektiver Identität ausgebildet hat, die bestimmte Werte, Normen, auch Praktiken etabliert hat und die das mit moralischen Qualitäten versieht, also die glaubt, dass die Art und Weise, wie sie Dinge bewerten, nicht eben zufällig ist, sondern dass es richtig so ist, und die davon ausgeht, dass es im Leben nicht nur richtig und falsch, also gelingend und ungelingend gibt, sondern gut und böse. Und dass das, was sie machen, gut, und was die anderen machen, böse ist“, sagt Vedder.
Gesellschaft gegen Gemeinschaft
Der Autor unterscheidet die Daseinsformen Stadt und Land, und entspinnt daraus eine These, der er über weite Teile des Buches nachgeht. Gesellschaft, das ist die Stadt, in der jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten. Gemeinschaft ist das, wozu einen das Land erzieht, schreibt Vedder:
Als wir aufs Land zogen, dachten wir, wir zögen von der Stadt an den See, aus den engen Straßenschluchten in die Weite der Natur, aus der stickigen Wohnung in das großzügige Haus mit dem sonnigen Garten. Das war jedoch eine viel zu oberflächliche Sicht der Dinge. Tatsächlich zogen wir aus der Gesellschaft in die Gemeinschaft. Der Umzug aufs Land ist ein Auswandern in eine andere Kultur, eine andere Zeit.
In Kapiteln wie Mia san mia, Im dunklen Tale der Gemeinschaft, Scham und Beschämung, Ekel und Macht oder Überkompensation und dicke Hosen arbeitet Vedder die Mechanismen heraus, mit denen das Dorf versucht, anders Denkende, anderes Ausschauende, anders Handelnde nicht nur auf Linie zu bringen, sondern auch Hierarchie innerhalb der dörflichen Gemeinschaft herzustellen. Besitz und ökonomische Verteilung spielen dabei eine bedeutende Rolle.
Urbanisierung der Dörfer als Lösung?
Björn Vedder:
„Nach einem Wert zu leben, heißt ja, den Wert zu verteidigen. Werte können aber nur durch andere Werte verteidigt werden und das führt sozusagen zu einer permanenten Abwehrhaltung, die Menschen immun macht gegen Kritik und Veränderung.“
Es ist also ziemlich eng auf dem Land, und von Selbstentfaltung keine Spur. Vedder arbeitet die Mechanismen der Denunziation, Beschämung, Kontrolle heraus.
Die Dorf-Bewohner kommen eigentlich nie gut weg. Das ist zuweilen irritierend, und man fragt sich, ob der Autor Menschen überhaupt mag. Irgendwann aber kapiert man, dass Vedder eben gern zugespitzt erzählt.
Lösungen sieht er auch und die haben mit der Urbanisierungen der Dörfer zu tun. Je näher wir uns rücken, desto ferner können wir uns werden. Tolle Thesen sind das, und weil Vedder sehr gut schreiben kann, ist es auch ziemlich unterhaltsam zu lesen.
Mehr Literatur zum Leben auf dem Land
Buchkritik Lola Randl - Angsttier
Ein Pärchen zieht aufs Dorf, doch bald geraten sie mit den Einwohnern aneinander, bis der Mann durchdreht. Lola Randl entzaubert in ihrem neuen Roman "Angsttier" einmal mehr die trügerische Idylle des Landlebens und probiert sich am Horrorgenre.
Rezension von Pascal Fischer.
Matthes & Seitz, 174 Seiten, 18 Euro
ISBN 978-3-7518-0060-0
Buchkritik Werner Bätzing - Das Landleben. Geschichte und Zukunft einer gefährdeten Lebensform.
Traditionelles Landleben in Zeiten boomender Metropolen: Anachronismus oder bewahrenswerte Lebensform? Der Geograph Werner Bätzing hat darüber ein couragiertes Buch geschrieben.
Rezension von Roman Kaiser-Mühlecker.
C.H.Beck-Verlag
ISBN 978-3-406-74825-7
320 Seiten
26,80 Euro