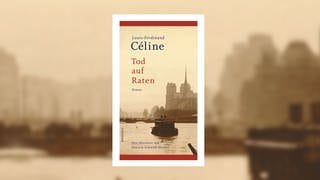Wenn er noch lebte, müsste einem der Schriftsteller Louis-Ferdinand Céline fast ein wenig leidtun. Kaum sucht irgendwer nach einem Beispiel dafür, dass in ihrem Charakter und in ihren politischen Haltungen fragwürdige Menschen trotzdem hervorragende Schriftsteller sein können, dauert es keine drei Sekunden, bis sein Name genannt wird. Dabei ist es noch nicht einmal sein richtiger Name, sondern der Künstlername des 1894 geborenen Arztes Louis Ferdinand Destouches.
Der Haken an dieser wohlfeilen Behauptung „übler Typ, aber guter Schriftsteller“ ist, dass sie zutreffend ist. Ja, Céline war Antisemit und Verfasser übelster Pamphlete. Und ja, er war ein herausragender Schriftsteller, dessen Werk bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat.
Das gilt auch für diesen Roman, der nun erstmals in deutscher Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel erscheint und dessen Publikationsgeschichte abenteuerlich ist, behauptete der Autor doch, das Manuskript sei ihm gestohlen worden, bevor es nun schließlich gemeinsam mit einer Reihe weiterer handschriftlicher Seiten im Nachlass aufgefunden wurde. „Krieg“ erzählt von Célines Erfahrungen als Soldat im Ersten Weltkrieg und eröffnet mit der eindrucksvollen Szene, in der der Ich-Erzähler nach einer Nacht inmitten des Gefechtslärms aus einer Bewusstlosigkeit erwacht, das linke Ohr an den Boden geklebt vom Blut.
Man darf naturgemäß nicht erwarten, dass Céline in seinen Schilderungen Rücksicht auf zarte Gemüter nimmt. Ideologisch bleibt das Buch im Vagen: Die pathetische Begeisterung der Öffentlichkeit für den Krieg verspottet Céline im gleichen Maß wie er es ablehnt, aus seinen Erfahrungen allgemeingültige Forderungen abzuleiten. „Krieg“ ist kein Pamphlet, sondern schlicht große Literatur.