Kann das sein? Seit jeher faszinieren optische Täuschungen die Wissenschaft und Künstler*innen lassen uns gerne mit den Möglichkeiten der optischen Täuschungen an unseren Sinnen zweifeln. Die Grenze zwischen Kunst und Realität verschwimmt.
Kunst der optischen Täuschung in der Antike
Schon aus dem antiken Griechenland wurde die schöne Geschichte überliefert, dass die Maler Parrhasios und Zeuxis sich einst einen Wettstreit geliefert haben sollen: Wer kann naturalistischer malen?
Der Überlieferung des Geschichtsschreibers Plinius der Ältere nach, malte Zeuxis also Trauben, die so echt wirkten, dass hungrige Vögel nach ihnen pickten. Als er dann ganz stolz das Bild seines Rivalen begutachten wollte, bat er ihn, doch endlich den Leinenvorhang davor beiseite zu schieben, um dann festzustellen, dass er selbst getäuscht wurde. Der Vorhang war gemalt. Zeuxis hatte es zwar geschafft, Vögel zu täuschen, der Konkurrent aber hatte ihn hinters Licht geführt.

Die vermeintliche Kuppel in der Jesuitenkirche in Wien
Wenn es um optische Täuschungen – oder „Trompe-l’œils“ (wörtlich aus dem Französischen übersetzt: Augentäuschungen) geht, zweifeln wir immer wieder allzu gerne an unseren Augen. Die Art der Kunst spielt mit den Erwartungen und der Wahrnehmung der Betrachter*innen.
Und so wundern wir uns auch erstmal nicht, wenn wir in eine Kirche wie die Jesuitenkirche in Wien gehen. Dabei wirkte der Bau doch von außen gar nicht so imposant und hoch, wie von innen. Die Lektion: Auch in Kirchen wird geschummelt.
Optische Vergrößerung durch Pozzos Trompe-l’œils
Der Trick: Der italienische Maler und Architekt Andrea Pozzo hat hier eine imposante Kuppel an die flache Decke gemalt und den Kirchenbau damit zumindest optisch vergrößert. Die Scheinarchitektur trügt.

Die perfekte Illusion
Den Rahmen der Malerei zu sprengen – das scheint das erklärte Ziel der optischen Täuschungen in der Kunst zu sein. Ein beliebtes Motiv liegt darum auf der Hand: wenn sich der Bildgegenstand sozusagen selbstständig macht und aus dem Rahmen auszubrechen scheint. Berühmtes Beispiel: das Gemälde „Flucht vor der Kritik“ (spanisch: Escapando de la critica) von dem Katalane Pere Borrell del Caso von 1874.

Mit weit aufgerissenen Augen scheint ein Junge im Begriff zu sein, aus einem (falschen) goldenen Bilderrahmen in eine andere Welt zu klettern. Raus aus der Welt der Zweidimensionalität, rein in die Realität auf der anderen Seite des Bilderrahmens. Eine fast perfekte Illusion. Ursprünglich wollte Berrell del Caso sein Gemälde: „Una cosa que no pot ser“ – also „Ein Ding der Unmöglichkeit“ nennen.
Thomas Demand rekonstruiert Pressefotos
Auch im 20. Jahrhundert hält die Kunst an dem Spiel mit der Faszination an optischen Täuschungen fest. Der Fotokünstler und Bildhauer Thomas Demand zum Beispiel kommt sozusagen wieder auf die Überlieferung von Parrhasios und Zeuxis zurück, als er 2011 im Frankfurter Städel Museum einen purpurfarbenen Vorhang aufhängt.
Bei genauerer Betrachtung aber wird deutlich: Auch dieses vermeintliche Brokat-Schwergewicht ist nicht mehr als eine optische Täuschung. Eigentlich ist es nur eine flache Wandbespannung.

Der Künstler ist mit täuschend echten Inszenierungen der Wirklichkeit bekannt geworden. Sein Arbeitsprozess beginnt mit einem realen Pressefoto, das ihm als Inspiration gilt – zum Beispiel der Kontrollraum im havarierten Atomkraftwerk in Fukushima.
Dann baut er die Aufnahmen mit unglaublicher Akribie als Modelle aus Papier und Karton nach. Die Modelle fotografiert er wieder. Erst bei genauer Betrachtung kann man einen Unterschied erkennen. Die Bilder eint: Menschen sucht man vergeblich. Es sind nur leere Räume, die ihre Geschichte erzählen.

Auch Gerhard Richter spielt mit optischen Täuschungen
Und auch Gerhard Richter, einer der bekanntesten und renommiertesten Künstler Deutschlands greift das Thema der optischen Täuschung immer wieder auf. Vor allem die zentrale Frage in der Kunst nach Illusion, Schein und Wirklichkeit.
Mit ganz unterschiedlichen visuellen Techniken macht Richter deutlich, wie begrenzt die menschliche Wahrnehmung ist und wie vielfältig dagegen die Möglichkeiten der Manipulation und Täuschung. Das kann ganz einfach sein: zum Beispiel mit einem Ölgemälde von einem vermeintlich umgeschlagenen Blatt von 1965.
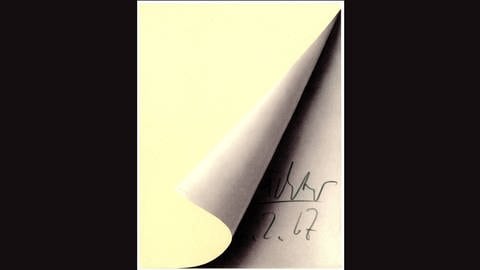
Das Motiv wiederholte er 1967 unter dem Titel „Blattecke“ als Offsetdruck in Grau und Elfenbein auf Karton. Die Drucke enthalten jeweils in Bleistift die Signatur des Künstlers und das entsprechende Datum rechts unten unter dem „umgeschlagenen“ Blatt.
Optische Täuschungen im Internetzeitalter
Und natürlich haben es die optischen Täuschungen in der Kunst auch ins Internetzeitalter geschafft. Auf YouTube werden die Videos des britischen Künstlers Howard Lee millionenfach geklickt.
Er zeigt, wie er neben einer Cola-Dose eine täuschend echt aussehende falsche Dose daneben zeichnet. Oder einen Hotdog. Nur zweimal hinschauen reicht da nicht. Hyperrealismus.
Auch Street Art spielt mit Illusionen
Verblüffende optische Täuschungen können uns inzwischen auch jeden Tag auf der Straße begegnen. Weil sich auch Street Art Künstler bei der Trompe-l’œil-Technik bedienen.
Zum Beispiel der Künstler Dan Witz, auch bekannt als „Godfather of Street“, der heute weltweit bekannt ist. Ursprünglich kommt Witz aus Chicago. Seine oft humorvollen Bilder finden sich inzwischen aber auch in Deutschland. Eine aufsehenerregende Street-Art-Aktion führte ihn unter anderem 2012 nach Frankfurt.

Humor steht bei diesen Werken aber überhaupt nicht im Vordergrund. Es geht darum, kritisch auf das Schicksal von verfolgten Aktivisten aufmerksam zu machen. Bei „Klagemauern für Gerechtigkeit“ nutzte der Künstler die Mauern und Brückenpfeiler der Stadt und gestaltet Kellerfenster und Schächte sozusagen zu Gefängniszellen um, hinter deren Gitterstäben man politische Gefangene erahnen kann.
Die Kunst soll die Menschen bewusst irritieren und so in jeder Hinsicht zum Innehalten und Nachdenken animieren.
Virtual Reality baut auf optische Täuschungen
Und auch Virtual Reality, die in der aktuellen Kunst immer wichtiger wird, bedient sich der optischen Täuschung, die als dreidimensionale Realität wahrgenommen wird.
In vielen Virtual-Reality-Brillen sind zwei Displays verbaut, die das Bild erzeugen. Das virtuelle Bild ist für jedes Auge anders ausgerichtet, dadurch verschiebt sich die Bildperpektive. Die Augen nehmen die Projektionen als reale Bilder wahr und im Gehirn setzt sich ein virtueller Raum zusammen.
Reiz hinter optischen Täuschungen bleibt über die Jahrhunderte gleich
Streng genommen ist das erklärte Ziel dieser Form der Kunst seit Jahrhunderten, uns auf den Arm zu nehmen, uns eben bewusst zu täuschen. Aber angesichts der anhaltenden Faszination für gelungene Illusionen hat es der Philosoph Theodor W. Adorno gut auf den Punkt gebracht: „Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein.“


