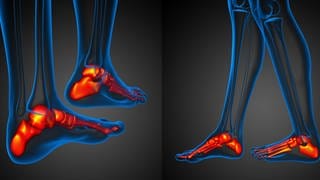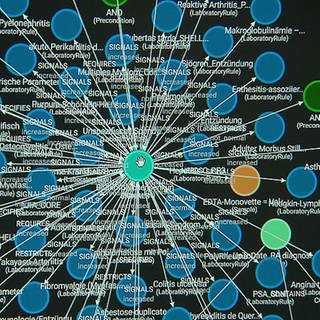Rheumatische Erkrankungen können das Leben der Patientinnen und Patienten massiv einschränken. Wenn die Diagnose einmal gestellt ist, begleitet die Erkrankung die Betroffenen oft ein Leben lang. Zu den häufigsten Symptomen von Rheuma zählen unter anderem: Schmerzen bei Bewegungsabläufen des täglichen Lebens, sowie Schwellungen der Gelenke.
Lange Wartezeiten für fachärztliche Diagnose und Behandlung
Wenn der Verdacht besteht, dass man eine rheumatische Erkrankung haben könnte, braucht man erstmal eines: Geduld. Mehrere Monate kann es dauern, bis man einen Termin in einer Fachambulanz oder -praxis erhält. Zeit, die häufig von Schmerzen begleitet wird.
Und auch dann kann es noch dauern, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Vor allem bei Frauen: Bei der systemischen Sklerose dauert es zum Beispiel im Schnitt ein Jahr länger als bei Männern, bis die Diagnose gestellt wird und die Symptome behandelt werden können.
Die Gründe dafür sind vielfältig: Zum Beispiel haben Männer häufig „typischere“ Symptome, die leichter zu erkennen sind. Frauen hingegen haben diffusere Beschwerden. Auch bilden sich bestimmte Marker und Antikörper im Blut später, sodass die eindeutige Diagnose schwieriger wird.

Zahl rheumatisch-entzündlichen Erkrankungen in Deutschland steigt
Für komplexe Fälle braucht es Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der rheumatisch-entzündlichen Erkrankungen. Doch hier könnte es in Zukunft kritisch werden, erklärt Christoph Baerwald, ehemaliger Leiter der Abteilung Rheumatologie am Universitätsklinikum Leipzig. Denn die Zahl der Patientinnen und Patienten steigt.
Darauf deutet auch eine Untersuchung des Deutschen Rheumaforschungszentrums hin, die dieses Jahr veröffentlicht wurde. Darin haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die aktuelle Datenlage zur Häufigkeit der unterschiedlichen rheumatischen Erkrankungen in Deutschland angeschaut. Sie sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass die "Häufigkeit größer ist, als man das gedacht hat. Dass man jetzt wirklich davon ausgehen kann, dass es 2,2 bis 3 Prozent sind der Erwachsenen, die eine entzündlich rheumatische Erkrankung haben“, so der Rheumatologe Baerwald.
Baerwald geht davon aus, dass wir in Zukunft mehr Rheumatologen,und Rheumatologinnen benötigen werden, um die Versorgung zu gewährleisten. Das könnte nach seiner Einschätzung durchaus ein Problem werden.

Sozioökonomischer Status beeinflusst die Entstehung rheumatischer Erkrankungen
Der Anstieg hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Offenbar gibt es äußere Faktoren, die einen Einfluss auf die Entstehung einer rheumatischen Erkrankung haben, so Baerwald. So zeige eine große, britische Studie beispielsweise, dass der sozioökonomische Status eine Rolle spiele: Je niedriger dieser in der Untersuchung war, desto häufiger traten die rheumatischen Erkrankungen auf.
Doch auch das Alter und der medizinische Fortschritt sind nach Baerwalds Einschätzung von Bedeutung: „Wir wissen, dass im höheren Alter das Risiko für entzündlich-rheumatische Erkrankungen steigt, deshalb hat es mit der demografischen Entwicklung zu tun. Wir haben diagnostische Möglichkeiten, sodass wir manche rheumatischen Erkrankungen auch früher erkennen. Das sollte immer unser Bestreben sein“. Denn je früher die Behandlung begonnen werden kann, desto besser sind oft ihre Erfolge.
Außerdem könnte man dann in Zukunft vielleicht noch einen Schritt früher ansetzen, erklärt Andrea Rubbert-Roth, stellvertretende Leiterin der Klinik für Rheumatologie am Kantonsspital St. Gallen.
„Es ist eine Zukunftsmusik, aber wie ich finde es sehr spannend, zu überlegen: Können wir die Krankheit vielleicht so früh diagnostizieren, dass wir sie vielleicht einmal verhindern können?“

Blutmarker zeigen erhöhtes Risiko für rheumatische Erkrankungen
Schon länger sind Blutmarker bekannt, anhand derer man bereits Jahre vor den eindeutigen Symptomen ein Risiko für eine rheumatische Erkrankung erkennen kann. Vor allem, wenn Menschen zusätzlich zu den auffälligen Blutwerten bereits erste Beschwerden wie Gelenkschmerzen oder Sehnenscheidenentzündungen aufweisen. Dann weiß man heute: Die Wahrscheinlichkeit, dass sie später eine echte rheumatische Erkrankung entwickeln, ist recht hoch.
In mehreren Studien, die zum Teil bereits veröffentlicht oder auf Fachtagungen vorgestellt wurden, hat man daher nun getestet, ob man eine Erkrankung solcher Risikopatientinnen und -patienten durch eine frühzeitige Gabe von unterschiedlichen Medikamenten verhindern kann. Das gelang nicht in allen Studien: Zum Teil gaben die Probandinnen und Probanden zwar an, sich besser zu fühlen als die Placebo-Gruppe. Es wurden jedoch nicht weniger Fälle von rheumatischen Erkrankungen festgestellt. In einer anderen Studie hingegen gab es nach einer sechsmonatigen Gabe eines anderen Medikaments signifikant weniger Erkrankungen als in der Vergleichsgruppe.
Für die Rheumatologin Rubbert-Roth ein interessanter Schritt in die richtige Richtung:
„Wenn es uns gelingen sollte, Risikopatienten zuverlässig zu diagnostizieren und eine zeitlich begrenzte Behandlung zu machen, ist das unter dem Strich attraktiv. Nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für die Gesellschaft und bei einer potenziell lebenslangen Erkrankung auch unter gesundheitsökonomischen Aspekten.“
Doch noch ist das Herausfischen der richtigen Risikopatienten eine große Herausforderung für die Mediziner. Und selbst wenn sie jemanden gefunden hätten, der in Frage kommt, ist die medikamentöse Rheuma-Prävention aktuell nicht möglich: Denn dafür sind die entsprechenden Medikamente noch nicht zugelassen.