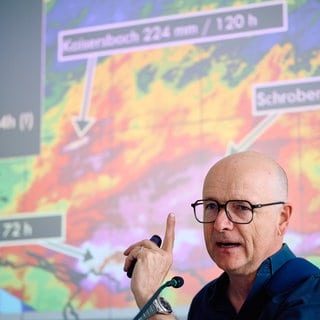Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999 fegte ein Orkan über Baden-Württemberg hinweg. Lothar genannt, brach er Baumstämme wie Streichhölzer und hinterließ chaotische Zerstörung. Später haben ihn manche als Chance betrachtet: für einen neuen Wald.
So entstand der Lotharpfad
Innerhalb einer halben Stunde lag der Wald. So erinnert sich Wolfgang Schlund, damals Leiter des Naturschutzzentrums Ruhestein, an den 26. Dezember vor 25 Jahren. Heute ist er Leiter des Nationalparks Schwarzwald und geht gerne über die Bohlenwege und Holzbrückchen des Lotharpfads.
Dort haben Forst und Naturschutz nach Lothar beschlossen, ein paar Hektar Fläche nicht aufzuräumen, sondern alles liegen zu lassen, wie es lag. Als Mahnmal, zur Erinnerung, und um zu sehen, was passiert. Wie die Natur mit dem Schaden umgehen wird.

Es wurde schnell wieder grün, sagt Wolfgang Schlund heute. Unter dem Sturmholz waren junge Bäumchen - Fichten und Tannen, die noch keinen festen Stamm hatten - gut geschützt, und sie wuchsen rasch. Bald folgten Vogelbeere und Birke, auch Buchen und ein paar Eichen.
Nach dem Orkan: Wald im Wandel
Für die Natur, meint Schlund, war das gut so. Der Wald sei jetzt vielfältiger als früher. Und er verändert sich immer. Im Nationalpark will man das so. Allerdings, so attraktiv der Lotharpfad für Besucher ist, als Wirtschaftswald könnte man den nachgewachsenen nicht nutzen. Zu schwierig sei es, an einzelne Bäume heranzukommen, um sie zu fällen.

Für viele Waldbesitzer, sagt Schlund, war Lothar eine Katastrophe. Das Erbe früherer Generationen einfach weggemäht, das Holz zersplittert und unbrauchbar, die Holzpreise im freien Fall. Denn Lothar hatte ja nicht nur in Baden-Württemberg gewütet, auch in Frankreich, der Schweiz und Österreich richtete er verheerende Schäden an. Unmengen von Sturmholz waren plötzlich auf dem Markt.
Das Erbe von Generationen zerstört
Jochen Bier, der Vorsitzende des Waldbesitzervereins Nordschwarzwald, sagt, es habe ihn eiskalt erwischt, die Arbeit von Jahren war in Minuten zerstört. Er habe während Lothar am Fenster gestanden und beobachtet, wie der Sturm mit unfassbarer Gewalt ganze Waldflächen einfach umgeblasen habe. Angst und bang sei ihm da geworden.
Man konnte die Katastrophe auch als Chance nutzen, aber: lieber sowas nicht mehr!
Manche hätten die Chance genutzt, ihren Wald nach der Katastrophe anders und vielleicht stabiler wiederaufzubauen. Es gab Zuschüsse, man konnte mehr Laubholz einbringen, wie es inzwischen von Forstleuten empfohlen wird. Aber klar: das wäre auch ohne Orkan möglich gewesen, planmäßig und überschaubar.
Lothar im Schönbuch: Eine Million Festmeter Sturmholz
Auch im Schönbuch hat der Orkan Lothar vor 25 Jahren immense Schäden angerichtet. Rund eine Million Kubikmeter Sturmholz bilanziert der Geschäftsführer des Naturparks, Mathias Allgäuer. Hätte man sie auf Eisenbahnwaggons geladen, hätten die Gleise die gesamte Strecke von Tübingen bis Düsseldorf gebraucht.

Allgäuer sieht im Nachhinein auch Positives an der Katastrophe. Vor Lothar habe es im Schönbuch 40 Prozent Laubbäume gegeben, 60 Prozent Nadelgehölze. Das Verhältnis sei nun mindestens umgekehrt. Die Fichten hätten die Förster noch lange nicht ernten dürfen, insofern sei es auch hilfreich gewesen, dass der Orkan Platz schuf für Eichen und Buchen.

Denn ein Wald mit hohem Laubanteil kann dem Klimawandel tendenziell besser standhalten, sagt Allgäuer. Auch wenn man sich nicht auf dieser Erkenntnis ausruhen darf, denn auch die Buche hat bereits Schwierigkeiten mit weniger Niederschlag und höheren Temperaturen.
Gemeinden haben Einnahmequelle verloren
Die Natur hat vieles selbst wieder gut gemacht. Das sieht auch Susanne Kaulfuß vom Kreisforstamt Freudenstadt so. Aber erstmal waren die Orkanschäden für viele Kommunen hart. Manche, wie Pfalzgrafenweiler, haben die Hälfte ihres Holzes verloren. Erst jetzt, 25 Jahre später, machen sie endlich kein Minusgeschäft mehr mit ihrem Wald, sagt Kaulfuß.

Fichten raus, Tannen rein
Jetzt können sie sogar wieder Geld mit Bäumen verdienen, die erst nach Lothar nachgewachsen sind. Immerhin als Papier- oder Industrieholz ließen sich die neuen Stämme bereits vermarkten. Das sei auch ökologisch sinnvoll, weil man vielfach Fichten aus den Wäldern holen kann, um Platz zu schaffen für Tannen, Kiefern oder Laubbäume, von denen man in einem gesunden Mischwald mehr haben möchte.
Bedeutung des Privatwalds hat sich gewandelt
Jochen Bier, der Vorsitzende des Waldbesitzervereins Nordschwarzwald, fürchtet, dass viele private Waldbesitzer sich diese Arbeit nicht mehr machen wollen oder können. Früher habe man im Sommer auf dem Feld und im Winter im Wald gearbeitet. Inzwischen haben die Leute andere Berufe, der Wald läuft nur nebenher.
Und wenn man nicht dazukommt, sich zu kümmern, dann setzt sich am Ende die Fichte durch. Gerade der Baum, den man eigentlich ein wenig zurückdrängen will. Aber selbst für viele, die den Wald zwar geerbt, aber wenig Zeit für ihn haben, gelte: Sie wollen sich von diesem Erbe nicht trennen. Das hat einen Grund: Ein Wald hat nie nur mit Arbeit und Profit zu tun, sondern immer auch mit Gefühlen.