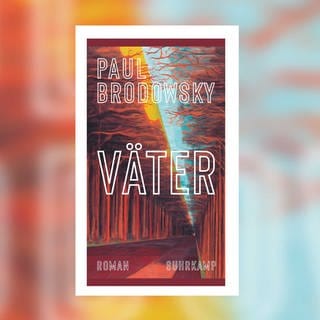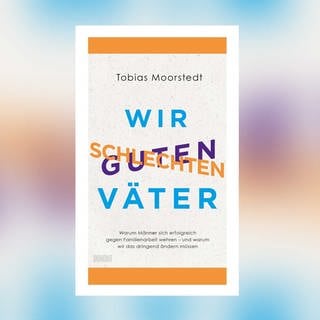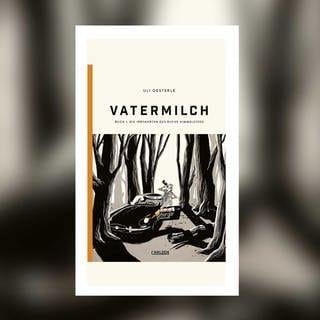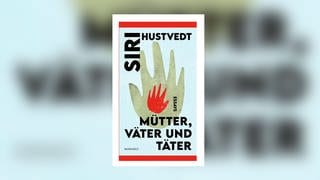Wenn es um Kindererziehung geht, spielen Väter oft die zweite Geige. Auch, weil Frauen immer noch den Großteil der Sorge- und Familienarbeit übernehmen. Aber sind Männer wirklich weniger geeignet, Kinder zu betreuen und zu erziehen? Diese Meinung hält sich nicht nur in konservativen Kreisen hartnäckig.
Seit Mitte der 1970er gibt es Väterforschung. Eine ihrer Vertreterinnen ist die Entwicklungspsychologin und Bindungsforscherin Lieselotte Ahnert. Ihre Erkenntnisse hat sie in dem Buch "Auf die Väter kommt es an" festgehalten. Sie und ihre internationalen Kollegen verschiedener Disziplinen sehen heute den väterlichen Beitrag für die Entwicklung von Kindern mit ganz anderen Augen.
Väter, so wie sie sind, geben wichtige Entwicklungsimpulse für das Kind. Wir haben in unserer eigenen Forschung festgestellt, dass bestimmte Dinge den Kindern unglaublich guttun und sie damit sogar besser fahren als das, was Mütter normalerweise machen.
Jeder kann Vaterfigur sein
Vater für ein Kind zu sein ist nicht auf biologische Väter in heterosexuellen Partnerschaften beschränkt. Eine Vaterfigur mit enger Bindung zum Kind kann genauso ein in einer schwulen Paarbeziehung lebender Vater sein, ein Stief- und Adoptivvater, ein alleinerziehender Vater oder ein engagierter Onkel.
Auch gibt es natürlich nicht das EINE, typische Vaterverhalten. Aber bei der wissenschaftlichen Beobachtung konnten Väterforscherinnen in verschiedenen Ländern doch immer wieder klar bestimmte Verhaltenstendenzen herausfiltern: Väter spielen wilder, sprechen anders mit ihren Kindern und stellen mehr Fragen. Und ihr Gehirn verändert sich, je mehr Zeit sie mit ihren Kindern – vor allem allein – verbringen.
Väter spielen wilder

Beim Toben können kleine Kinder in einer geschützten Situation mit ihren Vätern ein Wechselbad der Gefühle erleben. Lust und Vertrauen, aber auch Aufregung und Furcht folgen dicht aufeinander. Die Kinder erfahren, dass die Welt von einer Schrecksekunde nicht untergeht. Und sie lernen, wie man unangenehme Gefühle regulieren kann.
Aber nur, wenn der Vater in solchen Momenten die Feinfühligkeit hat, das Kind nicht zu überfordern, entstehen Vertrauen und Vaterbindung, sagt Entwicklungspsychologin Lieselotte Ahnert.
Da ist es ganz wichtig, dass die Väter in diesen Situationen das Vertrauen des Kindes bekommen und abschwächen, im richtigen Moment das unterbrechen, wenn sie merken: Jetzt ist der Spaß bald zu Ende beim Kind, und das Kind praktisch wieder rückführen in ein emotionales Gleichgewicht.
Wilde, körperbetonte Spiele sind wichtige Impulse für die Entwicklung des kindlichen Emotionssystems, sagt die Väterforscherin. Kinder, die viel wild gespielt hatten, kamen später im Leben besser mit herausfordernden Situationen wie Angst und Stress klar und hatten eine bessere Selbstkontrolle, zeigen Studien.
Väter sprechen anders mit Kindern

Schon 1975 hat die Psycholinguistin Jean Berko-Gleason von der Boston University festgestellt, dass Väter dazu tendieren, ihr Sprachniveau weniger dem von Kindern anzugleichen. Verschiedene Studien, so sagt Väterforscherin Lieselotte Ahnert, hätten seither bestätigt, dass Väter dazu neigen, Kinder ab einem gewissen Alter mit einer komplexeren Sprache zu konfrontieren, wie sie außerhalb der Familie gesprochen wird. Und das ist ein Entwicklungsanreiz.
Sie sind da ungeschickter, sie können nicht von ihrer Erwachsenensprache gut ablassen, sie verwenden zum Teil vielleicht auch Fremdwörter, wenn sie mit dem Kind sprechen. Sie sind auf jeden Fall der schwierigere Kommunikationspartner für das Kind.
Und das ist erst einmal ziemlich überraschend. Denn Männer wirken in der Kommunikation mit Kindern ja oft eher wortkarg und auch nicht so einfühlsam wie Mütter.
Väter stellen mehr W-Fragen

Und noch etwas fiel Forschenden in experimentellen Spielsituationen auf. Sie beobachteten getrennt voneinander Väter und Mütter mit ihren Kindern und stellten fest: Die Väter stellten den Kindern viel mehr W-Fragen als Mütter. Dafür, erläutert Ahnert, müssen Kinder sich richtig anstrengen und alles aufbieten, was sie sprachlich schon gelernt haben.
Also "wer", "was", "wie", "warum" – sodass Kinder sich erklären müssen. Und man kann da sehr, sehr gut nachweisen, mittlerweile in jetzt sehr vielen Studien, und wir haben das auch getan, dass genau diese Sprachsituation die Sprachproduktion, also das Sprechen des Kindes, antriggert. Denn wenn ein Vater dauernd fragt, dann ist das Kind bemüht, ihm das zu erklären.
Kinder, die häufig mit väterlichen W-Fragen konfrontiert waren, entwickelten sich sprachlich merklich besser als andere. Die Fehler der Kleinen korrigierten die Väter dabei ab einer bestimmten sprachlichen Kompetenzstufe kaum noch, um die Mitteilungsfreude der Kinder zu erhalten. So die beobachtete Tendenz.
Je länger Väter beim Kind sind, desto mehr verändert sich ihr Gehirn

Die Analysen zeigen: Je mehr Väter in die Fürsorge investieren, desto mehr passt sich ihr Gehirn an. Können sich also Väter am Ende genauso liebevoll und fürsorglich auch um kleine Kinder kümmern wie Mütter? Hier gibt Geschlechterforscherin Johanna Possinger eine eindeutige Antwort:
Die Forschung ist sich einig darin, dass Menschen unabhängig ihres Geschlechts gleichermaßen gut in der Lage sind, sich um die Bedürfnisse von Kindern zu kümmern. Hier gibt es eigentlich keinen Geschlechterunterschied, was Mütter oder Väter hier besser machen.
Aber das passiert nicht automatisch. Denn um fürsorgliche Väter zu werden, passen sich Männer nicht nur neuronal, sondern auch hormonell und psychisch an die Vaterrolle an. Und zwar umso stärker, je mehr sie sich mit dem Kleinkind beschäftigen. Die Psychologin und Neurobiologin Ruth Feldman von der israelischen Bar-Ilan-Universität hat mit Experimenten und bildgebenden Verfahren das Gehirn von Eltern untersucht. Ihre Studien zeigen, dass das väterliche Gehirn so flexibel ist, dass es sich abhängig davon entwickelt, wie viel Kinderbetreuung dieser Vater leistet. In einem Video spricht sie auf Englisch über "The Father's Brain":
Dazu gehört auch Zeit ohne die Mutter. Das ist laut Väterforscherin Lieselotte Ahnert die Voraussetzung, damit sich Körper und Psyche des Vaters auf das Kind einschwingen können. Am wichtigsten ist für Kinder vor allem eines, findet Johanna Possinger:
Es gibt ein schönes Zitat eines amerikanischen Entwicklungspsychologen, Urie Bronfenbrenner, das ich an so einer Stelle immer gerne anführe. Der hat gesagt: Jedes Kind braucht mindestens einen Erwachsenen, der verrückt nach ihm ist. Und dann geht es dem Kind gut.
SWR 2023