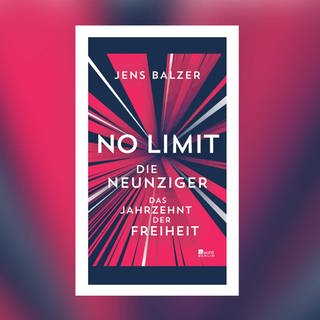Das Frankfurter Museum of Modern Electronic Music – MOMEM – will in einer aktuellen Ausstellung die Geschichte des Techno dekolonialisieren. „The Birth of Techno - from Berlin to Detroit“ zeigt, wie sich der neuartige Sound im Berlin der Wendezeit zu einem Massenphänomen entwickelte und dabei die afroamerikanischen Wurzeln des neuartigen Sounds in Vergessenheit gerieten. Das MOMEM selbst reagiert mit der Ausstellung auf Kritik, die dem Haus bei seiner Eröffnung 2022 entgegenschlug.
Geschichte von Techno wird meist aus europäischer Perspektive erzählt
Wer das Momem in Frankfurt betritt, meint, in einem Technoclub gelandet zu sein. Club-Lautsprecher als Empfangstresen. Die Wände sind dunkel. Neonlicht. Es laufen Clubtracks.
Im Foyer: Die Ausstellung „The Birth of Techno. From Detroit to Berlin“. Auf großen Texttafeln mit Fotos und Videos möchte sie die Geschichte von Techno dekolonialisieren.

Denn die wird meist aus europäischer Perspektive erzählt. Viele glauben, dass Techno eine Erfindung von Berliner oder Frankfurter Clubs sei. Dabei stammt die Musik aus den queeren und afroamerikanischen Subkulturen der USA.
Zeitreise ins Detroit der frühen 80er Jahre
Und so nimmt die Ausstellung mit auf eine Zeitreise zurück ins Detroit der frühen 80er Jahre: Als hier, inmitten des wirtschaftlichen und sozialen Zerfalls der einstigen US-Industriestadt eine musikalische Revolution passierte.
Die Kreativszene von Detroit bestand fast ausschließlich aus Afroamerikaner*innen. Ihnen ging es erstmal gar nicht um Party. Die neue Musik war ein Experiment. Eine Form des Widerstands.
Zur Eröffnung vor anderthalb Jahren hagelte es Kritik
Nun zeigt ausgerechnet das Frankfurter Momem diese Ausstellung. Das lässt aufhorchen. Denn Deutschlands erstes und einziges Technomuseum steht unter Beobachtung.
Zur Eröffnung vor anderthalb Jahren hagelte es Kritik. Ausgerechnet eine große Einzelausstellung über den Frankfurter Star-DJ Sven Väth. Personenkult statt inhaltlicher Tiefe. Nicht die internationale Diversität der Szenen, nicht die vielfältigen Wurzeln, sondern: Frankfurt. Als sei die Stadt in puncto Techno der Nabel der Welt. Stichwort: Whitewashing.
„Was uns unterstellt wurde, stimmt nicht.“
Ist die neue Ausstellung also eine Kurskorrektur? „Nein, ich glaube, die Ausstellung hätten wir so oder so gemacht“, sagt Museumsdirektor Alex Azary. Für die Kritik an seinem Haus hat er kein Verständnis.
„Wir haben hier nie irgendjemanden diskriminiert. Wir haben das ganze Club-Ding immer schon mit einer Offenheit in Verbindung gebracht. Die Ausstellung ist ein Statement um zu zeigen: Das was uns unterstellt wurde, stimmt nicht.“
Frankfurt sei die Wiege des Techno in Deutschland. Das anzuerkennen bedeute nicht, dass man die Pionierarbeit der Detroiter Szene ignorieren würde, sagt Azary.
Es habe verschiedene Städte gegeben, die für die Entwicklung der Musik bedeutend waren, aber in Deutschland sei Frankfurt die erste große Szene gewesen: „Das Ganze ist immer eine Entwicklung gewesen.“
Afroamerikanischen Wurzeln von Techno geraten vergessen
Bleibt die Frage, wer von dieser Entwicklung profitiert. Die Ausstellung „The Birth of Techno“ sagt: Detroit war es nicht.
Denn wer heute an Techno denkt, denkt ans Berghain, Loveparade, Raves und Exzess. Weiße, europäische DJs wurden Weltstars. Die afroamerikanischen Wurzeln von Techno geraten in Vergessenheit.
Es gelingt der Installation zu vermitteln, dass mit der Kommerzialisierung von Techno in den 90er Jahren auch ein kultureller Aneignungsprozess stattgefunden hat.
Der Dancefloor ist heute wieder politisch
Museumsdirektor Alex Azary findet es gut, dass man in der Szene heute kritisch darüber diskutiert. Aber er sagt auch: „Eigentlich ist das ne Diskussion der Leute, die nicht dabei waren, der Leute die zu spät geboren wurden und von Journalisten.“
Es stimmt. Es sind nicht die Raver der ersten Stunde, die dafür sorgen, dass der Dancefloor wieder politisch wird. Es ist eine junge Generation, und ihr Anliegen ist berechtigt.
Ausstellung spannt den Bogen in die Gegenwart
Die Ausstellung im Frankfurter MOMEM spannt den Bogen ins Jetzt. Wir lernen Netzwerke und Kollektive kennen, die sich für Vielfalt im Nachtleben einsetzen. Podcasts und Partyreihen, die die Ursprünge der Schwarzen Clubkultur sichtbar machen.
Es ist viel in Bewegung. Bleibt zu hoffen, dass Deutschlands Technomuseum auch zukünftig Raum bieten wird für die vielfältigen Debatten der Gegenwart.
Was geht - was bleibt? Zeitgeist. Debatten. Kultur. Alles nur geklaut: Wie problematisch ist kulturelle Aneignung in der Musik?
Das Konzert eines Didgeridoo-Spielers wird abgesagt. Es folgt, wie so oft, die mediale Empörung über eine vermeintliche Verbotskultur. An dem Fall sieht man: Die emotionale Diskussion um die kulturelle Aneignung lässt auch die Musikwelt nicht aus. Aber das Thema ist ambivalent, darum fragen wir uns möglichst differenziert: Wem gehört Musik? Und wann ist eine Aneignung wertschätzend, wann ist sie problematisch?
Zu Gast:
Tom Fronza, Didgeridoo-Spieler der Analogue Birds
Sarah Farina, DJ, Produzentin und Aktivistin
Keno Mescher, Musikjournalist
Mailt uns Feedback und Themenideen an kulturpodcast@swr.de.
Host: Philine Sauvageot
Showrunner: Julian Burmeister
Links zur Folge:
Doku über Little Richard: https://www.amazon.com/Little-Richard-I-Am-Everything/dp/B0BY4TYFC9
Detroiter Techno-Ausstellung im MOMEM: https://momem.org/
Jens Balzers Buch “Ethik der Appropriation”: https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/ethik-der-appropriation.html
Die Band Analogue Birds: https://www.analoguebirds.com/
Unser Podcast-Tipp: ICONIC - Modegeschichte mit Aminata Belli
https://www.ardaudiothek.de/sendung/iconic-modegeschichte-mit-aminata-belli/94764438/
Mehr zu Techno und Clubkultur
Musik Nature One – Techno-Festival auf ehemaliger Raketenbasis
Im August wird der Hunsrück zu Techno City, beim Festival „Nature One“ auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna. Wo heute gefeiert wird, ging es früher um Atomwaffen.
Buchkritik Jens Balzer – No Limit. Die Neunziger – das Jahrzehnt der Freiheit
Historische Rückblicke auf bestimmte Schicksalsjahre sind seit einer Weile Mode. Mindestens ebenso ergiebig kann es aber sein, eine ganze Dekade in den Blick zu nehmen. Der Publizist Jens Balzer widmet sich in diesem Sinne seit 2019 den zurückliegenden Jahrzehnten der Zeitgeschichte. Er begann mit den siebziger Jahren, 2021 folgte ein Buch über die Achtziger, und nun ist Balzers Rückblick auf die neunziger Jahre in die Läden gekommen. Ein äußerst süffig zu lesender Kultur- und Mentalitätsabriss mit vielen erhellenden Momenten, sehr unterhaltsam, wenn auch mit einigen tiefen Lücken.
Rezension von Michael Kuhlmann.
Rowohlt Verlag, 382 Seiten, 28 Euro
ISBN 978-3-7371-0173-8