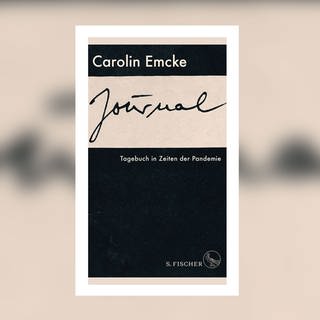Am 22. März 2020 beginnt in Deutschland der erste Corona-Lockdown. Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen. Absperrbänder, Klebestreifen und Plexiglas ordnen fortan das neue Lebensgefühl. Wie hat das Virus den Alltag verändert?
Das Virus kommt, die Bevölkerung zieht sich zurück
Die Bundesregierung verhängt am 22. März den ersten Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Ab nun dürfen sich nur noch zwei Personen treffen oder aber Personen, die in einem Haushalt leben. Schulen, Kultureinrichtungen, die Gastronomie und auch viele Arbeitsstellen sind zu diesem Zeitpunkt in den meisten Bundesländern bereits geschlossen. Deutschland erlebt einen kollektiven und verordneten Rückzug ins Private.

Der Lockdown soll zunächst für zwei Wochen gelten und als Entlastung für das bereits hoffnungslos überlastete Gesundheitssystem dienen.
„Ärzte, Pfleger, Sanitäter, Apotheker können nicht ins Home Office gehen. Sie sind diejenigen, auf die wir uns alle verlassen, wenn wir krank werden. Wir können sie dabei unterstützen: indem wir, wann immer möglich, zuhause bleiben.“
Die Angst vor der unbekannten Gefahr nimmt hässliche Züge an
Die Grenzen zu Nachbarländern mit einem stärkeren Infektionsgeschehen – fortan als Risikogebiete bezeichnet – werden äußerst kurzfristig schon vor dem Lockdown geschlossen, der trans-nationale Verkehr wird rigide kontrolliert. Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss vorsorglich zwei Wochen in Quarantäne.

Grenzgänger benötigen Sondergenehmigungen, um ins Nachbarland einreisen zu dürfen. Pendler berichten vermehrt davon, dass sie auf der anderen Seite der Grenze teilweise heftig angegangen werden. Das Klima wird rauer: Der Neid auf diejenigen, die sich offensichtlich freier als man selbst bewegen können, nimmt zu.
Auch asiatisch gelesene Personen berichten davon, aufgrund ihres Aussehens gemieden zu werden und sogar verbalen oder tätlichen Angriffen ausgesetzt zu sein. Die Angst vor der unbekannten Gefahr zeigt ihr hässliches Gesicht.
Wörter wie Kontaktbeschränkung oder Hygienekonzept werden zum festen Bestandteil des Vokabulars
Die Sorge vor dem bis dato unbekannten Virus ist groß. Schockierende Bilder aus Italien, den USA und Spanien befördern die Panik vor einem unkontrollierbaren Infektionsgeschehen – zumal es auch in Deutschland an Beatmungsgeräten und schützende OP-Masken mangelt. Auch die Hilflosigkeit der Wissenschaft, die mit Hochdruck an einer Impfung arbeitet, verunsichert die Bevölkerung.
Wörter wie Kontaktbeschränkung, Hygienekonzept, Inzidenzwert oder Alarmstufe werden fortan zum festen Bestandteil des deutschen Vokabulars. Absperrbänder, Klebestreifen und Plexiglasscheiben ordnen das neue Lebensgefühl in Abständen von 1,5 Metern.
Immer neue Wortschöpfungen erblicken das Licht der Welt. Sie geben in der komplizierten Zeit vermeintlich etwas Sicherheit: Lockdown-Light, Notbremse, Wellenbrecher, Osterruhe, Rettungsschirm, Brücken-Lockdown oder die Boosterimpfung sind Beispiele.

Corona kommt ins Museum
Mehrere Museen, darunter auch das Badische Landesmuseum in Karlsruhe, legen Sammlungen zur Corona-Pandemie an, um die Veränderungen in der Alltagskultur auch für die kommenden Generationen greifbar zu machen. Und auch in den sozialen Medien finden sich Sammlungsaufrufe, so etwa auf Twitter:
Zahlen werden zum ständigen Begleiter im Alltag
Zunehmend orientiert sich die Bevölkerung in dieser Zeit an Zahlen und Statistiken: Der morgendliche Blick auf Infektionswerte wird für viele zum festen Ritual – auch, weil mit Fortschreiten der Pandemie daran immer mehr Regelungen für den eigenen Alltag geknüpft werden: so etwa die Bestimmungen für die sogenannte Notbremse, die Schulschließungen, Ausgangs- oder Zugangsbeschränkungen regelt.
Es folgen immer neue Regelungen und Verordnungen, die im Föderalismus von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausfallen können. Alles setzt auf Reaktion: Äußerst kurzfristig werden politische Entscheidungen in die Tat umgesetzt und auch revidiert (man denke nur an die avisierte Osterruhe 2021, die schließlich doch nicht umgesetzt wurde).
Und es kommt zu skurrilen Effekten: In Deutschland wird Klopapier gehamstert, auch Desinfektionsmittel, Seife, Nudeln oder Mehl gehören zu den Produkten, die schon kurz vor Beginn des ersten Lockdowns in vielen Supermarktregalen fehlen.
Aus sozialer Distanz wird soziale Nähe
Doch es gibt auch große Solidarität: Die soziale Distanz führt zu sozialer Nähe. Vielerorts bilden sich ehrenamtlich Gemeinschaften, die isolierten, älteren und vorerkrankten Personen helfen, ihren Alltag trotz der Einschränkungen zu meistern. Einkaufs- oder Gassigeh-Gruppen entstehen in den sozialen Netzwerken, mit Gabenzäunen werden Obdachlose unterstützt. Auch Kinderbetreuung wird von vielen angeboten.

In den Pflegeeinrichtungen, deren Bewohner*innen besonders hart von den Kontaktbeschränkungen getroffen sind, treten Künstler*innen auf. Mit selbst gemalten bunten Plakaten an Balkonen und Fenstern zeigen viele Menschen, dass sie zu Hause bleiben. „Stay at Home“ wird das Schlagwort der Zeit, viele Prominente rufen in sozialen Netzwerken zum Zuhausebleiben auf.
Improvisation ist ein ständiger Begleiter
Viele tragen freiwillig selbstgenähte Masken. Landwirte, deren Erntehelfer*innen wegen der Reisebeschränkungen zunächst nicht ins Land kommen, erhalten spontan Hilfe von Personen, deren Arbeitsstellen wegen der Pandemie geschlossen sind, vornehmlich aus der Gastronomie. Weil Desinfektionsmittel Mangelware ist, stellen Winzer*innen kurzerhand aus dem Vorlauf welches her.
Generell ist es die Zeit der Improvisation: Kunstschaffende verlagern Auftritte ins Netz, Museen machen ihre Sammlungen digital zugänglich und Musiker*innen, Tänzer*innen oder Schauspieler*innen gehen neue Wege, um weiterhin proben und schließlich auch wieder auftreten zu können.
Obwohl die ersten Einschnitte in das tägliche Leben enorm sind, können sich nur wenige zu Beginn der Pandemie ausmalen, wie sehr das Corona-Virus den Alltag auf lange Sicht verändern wird. So wird etwa bis heute größtenteils aufs Händeschütteln verzichtet und in die Ellenbeuge genießt, Desinfektionsspender sind eher die Regel als die Ausnahme und OP-Masken sind inzwischen ein profaner Gebrauchsgegenstand.
Mehr zum Leben im Corona-Lockdown
Gespräch Liao Yiwu – Wuhan | Dokumentarroman
Am 23. Januar 2020 – vor genau zwei Jahren – ging die Stadt Wuhan in den Lockdown. Eine neue Atemwegserkrankung war ausgebrochen, die zunächst vertuscht und dann SARS-CoV2 genannt wurde. Kam sie wirklich – wie schnell behauptet wurde – von einem Wildtiermarkt? Oder doch aus dem nahegelegenen Hochsicherheitslabor, das just zu diesen hochgefährlichen Fledermaus-Viren forscht? Klären konnte dies nicht einmal die WHO, denn China gibt wenig preis.
Es ist genau diese chinesische Vertuschungspolitik, die den in Berlin lebenden Autor Liao Yiwu umtreibt. In seinem neuen Roman „Wuhan“ versucht er, in einem Mix aus fiktiver Heimreise und faktischer Internetrecherche etwas Licht in die Sache zu bringen. Mit seinem „Dokumentarroman“ hat er einen Literaturhybrid erfunden, der zwischen barockem Schelmenroman, journalistischer Fernrecherche und politischer Warnung oszilliert.
Katharina Borchardt im Gespräch mit Isabella Arcucci.
Aus dem Chinesischen von Brigitte Höhenrieder und Hans Peter Hoffmann
Verlag S. Fischer, 352 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-10-397105-7
Buchkritik Carolin Emcke - Journal. Tagebuch in Zeiten der Pandemie
Carolin Emcke berichtet in einem persönlichen Tagebuch von Begegnungen, Erlebnissen und Gedanken in Zeiten der Covid-Pandemie. So eröffnet sie Leserinnen und Lesern neue Perspektiven auf die gesellschaftlichen und politischen Ereignisse der Gegenwart.
Rezension von Judith Reinbold.
S. Fischer Verlag, 272 Seiten, 21 Euro
ISBN 978-3-10-397094-4