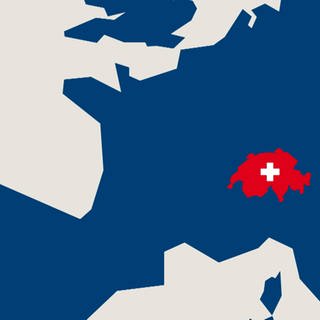Selbst mitdiskutieren und entscheiden: Im Schweizer Kanton Glarus können die Bürgerinnen und Bürger einmal jährlich in öffentlichen Gemeinde-Versammlungen über wichtige regionale Themen abstimmen. Eine solche "Landsgemeinde“ haben Studierende aus Esslingen und Dresden jetzt besucht, um dort direkte Demokratie live mitzuerleben. Dabei haben sie auch erlebt, wie respektvoll Sieger und Verlierer nach den Abstimmungen miteinander umgehen.
Tränen der Begeisterung für die Demokratie
Auf dem Gemeindeplatz versammelten sich zahlreiche Zuschauer und prominente Vertreter der Schweizer Bundespolitik, die jedes Jahr nach Glarus kommen. Auch deutsche Studierende erlebten den wichtigsten Tag im politischen Leben der Landsgemeinde. "Ich erwarte ein super Gemeinschaftsgefühl. Ich habe jetzt schon sehr viel darüber gehört", sagt Rahel Zaiss von der Hochschule Esslingen. Die direkte Demokratie sei für viele Deutsche unglaublich, so Peter Neumann von der TU Dresden. Der Professor organisiert regelmäßig die Studienreise nach Glarus.
Hier haben Studierende schon mit Tränen in den Augen auf dem Platz gesessen, weil sie das gar nicht fassen konnten.
Sachliche Diskussion statt Attacken
Während in Dresden zurzeit Gewalt gegen Politiker Schlagzeilen macht, verfolgten die deutschen Studierenden in Glarus sachlich geführte Diskussionen. Auf der Bühne mitten im Ort wurde ernsthaft über den geplanten Bau einer neuen Turnhalle debattiert. Die Sportstätte sollte größer werden als geplant - dazu wurden alle Argumente ausgetauscht. Schließlich trafen die Gemeindemitglieder ihre Entscheidung. Die deutschen Studierenden waren beeindruckt: Nele Preiss von der Hochschule Esslingen war begeistert von der Akzeptanz für die getroffenen Entscheidungen und Stella Benedek von der TU Dresden betonte, wie besonders der respektvolle Umgang miteinander und die Disziplin in Glarus gewesen seien.
Sobald entschieden war, war es demokratisch entschieden und für beide Parteien Gesetz. Man konnte zum nächsten Punkt übergehen. Das kenne ich aus Deutschland so nicht.
Keine verhärteten Fronten
Deutschland könne von der Diskussionskultur in der Schweiz lernen, glaubt Professor Neumann. Er betonte die Bedeutung der Kompromissfähigkeit und des Zuhörens, auch wenn es klare Niederlagen und Siege gibt: "Da wird niemand ins Abseits gestellt, auch wenn er verliert." Das sei etwas, was man mitnehmen könne.
Ich glaube da ist eine gewisse Grundsympathie da, die keinen ins Abseits stellt, auch wenn er verliert.
TU Dresden setzt auf Demokratieforschung
Die TU Dresden hat sich Demokratieforschung auf die Fahnen geschrieben. Das dazugehörige Deutsche Institut für Sachunmittelbare Demokratie (DISUD) veranstaltet jedes Jahr eine wissenschaftliche Studienreise, bei der Seminare und Gespräche an führenden Schweizer Universitäten stattfinden. Dabei werden auch Treffen mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur organisiert. Ein besonderer Höhepunkt der Reise ist der Besuch der Landsgemeinden in Glarus und Appenzell/Innerrhoden, den letzten Orten in der Schweiz, an denen die sogenannte Versammlungsdemokratie praktiziert wird. Um die Vernetzung der Wissenschaftler auf dem Gebiet der direkten Demokratie zu fördern, arbeitet das DISUD außerdem eng mit dem "C2D - Centre for Research on Direct Democracy" in Aarau zusammen.
Weitere Themen in Dreiland Aktuell vom 11.5.2024:
Die Schweiz und die Europäische Union verhandeln wieder über eine Regelung ihrer gegenseitigen Beziehungen. Unter anderem will die Regierung in Bern einen freien Zugang zum EU-Binnenmarkt. Es geht aber auch um Themen wie Zuwanderung: Ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in der Schweiz soll es nur für erwerbstätige EU-Bürger geben.
Im grenznahen schweizerischen Kloten im Kanton Zürich haben die Behörden damit begonnen mehrere Fußballplätze mit Plastikfolien abzudecken. Damit soll die Ausbreitung des Japankäfers verhindert werden. Der Japankäfer gilt als invasive Art und kann massive Schäden an mehr als 400 heimische Pflanzenarten verursachen.
Erneut hat im Elsass die Erde leicht gebebt - und wieder könnte eine Geothermie-Anlage die Ursache sein. Die Diskussion um mögliche negative Folgen dieser Art der Energie-Gewinnung hält an.