Der Mathematikunterricht in Baden-Württemberg soll modernisiert werden. Die Bildungspläne aus dem Jahr 2016 würden derzeit überarbeitet und zum kommenden Schuljahr in Kraft treten, teilte das Kultusministerium in Stuttgart mit. Eingearbeitet werden demnach Konzepte wie Datenanalyse und statistisches Denken. Auch Entwicklungen im Bereich der digitalen Bildung würden berücksichtigt, hieß es, beispielsweise bei der Tabellenkalkulation, der Geometrie oder Wahrscheinlichkeitsrechnung.
SWR Science Talk So vermittelt man erfolgreich Mathematik
Schlecht in Mathe – oft liegt das am langweiligen Unterricht. Dabei kann das Fach Spaß machen. Wie das gelingt, erläutert die Tübinger Mathematikerin Professorin Carla Cederbaum.
Algorithmen besser verstehen und auch anwenden
Darüber hinaus sollen die Lernenden zum Beispiel mehr als bislang erfahren, was Algorithmen sind und wie sie verwendet werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen sie selbst anwenden und entwickeln. Algorithmen bestimmen unter anderem, was für Inhalte in sozialen Medien ausgespielt werden.
Wie eine Sprecherin erläuterte, soll beispielsweise in den Bildungsstandards der Sekundarstufe I (also den Klassenstufen 5 bis 10) ein neuer Kompetenzbereich "Mit Medien mathematisch arbeiten" eingeführt werden. Dieser soll die digitale Bildung deutlich stärker verankern und die Rolle der Mathematik dabei betonen.
Die Macht ... (5/10) Die Macht der Algorithmen
Algorithmen filtern Nachrichten und Job-Bewerbungen. Sie haben Macht, bleiben aber unsichtbar. Sollte ihr Einsatz begrenzt werden, oder treffen sie gar gerechtere Entscheidungen?
Mathematik-Professor fordert: Lehrplan entrümpeln
Aus Sicht des Stuttgarter Mathematik-Professors Christian Hesse reicht das aber nicht. Er fordert nicht zuletzt angesichts des schlechten Abschneidens deutscher Schülerinnen und Schüler bei der jüngsten PISA-Studie im Fach Mathematik eine grundlegende Reform: "Es müsste ein richtiger Wumms her im Schulwesen in mancherlei Hinsicht", sagte Hesse, der auch zahlreiche populärwissenschaftliche Bücher zur Mathematik verfasst hat, der Deutschen Presse-Agentur.
Mathematik-Didaktiker fordern unter anderem, dass der Unterricht lebensnäher und praxisorientierter werden müsse. "Das sind die gleichen Vorschläge wie schon nach der letzten und vorletzten PISA-Studie und nichts hat sich geändert", kritisierte Hesse. In der Ende 2023 veröffentlichten PISA-Studie hatten die Schülerinnen und Schüler in Deutschland in den Bereichen Lesen, Mathe und Naturwissenschaften so schlecht abgeschnitten wie noch nie.
Der Unterricht müsste stark entrümpelt werden, etwa ein Viertel der Geometrie gestrichen werden, forderte Hesse. Der Professor für Stochastik sprach sich dafür aus, mehr statistische, datenanalytische und algorithmische Themen zu lehren. Die werden etwa im Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) wichtiger.

Experte für 100 Module statt weniger Fächer
Hesse schlug vor, die "Schubladisierung" in gut ein Dutzend Schulfächer aufzubrechen und stattdessen rund 100 Module wie Finanzwissen und Klimawandelkunde anzubieten, von denen manche frei wählbar sind. Darin sollte nicht nur Mathematik unterrichtet werden.
So könnten im Zusammenhang mit Vektoren bestimmte Ameisenarten als Beispiel herangezogen werden, die trotz eines Zickzackkurses auf der Suche nach Futter den schnellsten Weg zurück finden. "Die können Vektoraddition im Kopf rechnen, das können Menschen nicht", machte Hesse deutlich. Anhand dieses Beispiels ließen sich die Funktion von Vektorneuronen beschreiben oder auch aus der Physik, was es mit der Polarisation des Lichts auf sich hat - diese sei nämlich für die Ameisen entscheidend. "Dann wird auch die Sinnfrage auftauchen", sagte Hesse. Anders als bei Fächern wie Sprachen leide die Mathematik stärker darunter, dass der Sinn dahinter hinterfragt werde.
BW-Lehrer, Blogger und Bildungsaktivist im Interview Bob Blume zu schwachen PISA-Ergebnissen: "Sehen jeden Tag, was schief läuft"
Er ist Lehrer an einem Gymnasium in BW und spricht die Probleme an Schulen auf seinen Social-Media-Kanälen offen an: Bob Blume über schwache PISA-Ergebnisse, die Suche nach Schuldigen - und wichtige Freiräume im System Schule.
Forderung nach mehr Geld fürs Schulsystem
Hesse sprach sich darüber hinaus für eine bessere Stellung von Lehrkräften aus. PISA-Spitzenreiter Singapur investiere 20 Prozent des Staatshaushalts in das Schulsystem und die Lehrerbildung. "Prozentsätze in dieser Größenordnung sind bei uns natürlich nicht erreichbar, aber die im vergangenen Jahr bei uns aufgewendeten 4,6 Prozent des Staatshaushalts sind definitiv zu wenig", so der Mathematik-Professor. Das führe zu nicht ausreichender und veralteter Ausstattung an den Schulen und teils zu nicht optimal an neuen Medien ausgebildeten Lehrkräften. Das habe sich im Lockdown während der Corona-Pandemie deutlich gezeigt.
Dabei kritisierte Hesse, dass Deutschland im Vergleich zu viel Geld in den universitären Bereich investiert habe. "Einige der aufgewendeten Gelder wären besser investiert worden, wenn sie für die Aufwertung des Lehrerberufes durch bessere Bezahlung verwendet worden wären."
Kultusministerium: Das Land bezahlt bereits gut
Das baden-württembergische Kultusministerium entgegnete, im europäischen Vergleich bekämen Lehrkräfte in Deutschland, zusammen mit der Schweiz und Luxemburg, die höchsten Gehälter. "Das Land Baden-Württemberg verbeamtet seine Lehrkräfte grundsätzlich und bezahlt sehr gut", erklärte die Sprecherin. Hinzu kämen erhebliche geldwerte Zusatzleistungen wie Kinder- und Familienzuschläge, Pension und Sozialabgabenfreiheit - also deutlich mehr Netto vom Brutto.
Das Land Baden-Württemberg verbeamtet seine Lehrkräfte grundsätzlich und bezahlt sehr gut.
Um die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte zu verbessern und die Schulen zu entlasten, gebe es zudem Maßnahmen wie pädagogische Assistenz, "sozialindexbasierte Ressourcenzuweisung" und datengestützte Unterrichtsentwicklung.
Unter "sozialindexbasierter Ressourcenzuweisung" versteht man dabei, Schulen in Brennpunktregionen mit mehr Geld und Personal auszustatten.

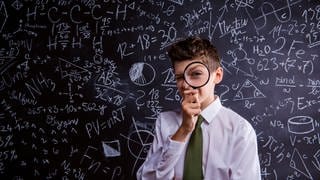














Kommentare (5)
Die Kommentarfunktion zu dieser Seite wurde geschlossen.
Wir freuen uns, dass Sie mit uns und anderen Nutzerinnen und Nutzern über dieses Thema diskutieren möchten. - Eine Diskussion würde voraussetzen, dass Kommentare zeitnah veröffentlicht werden und eine zeitlang beantwortet werden können. Das ist häufig nicht gegeben. ++++ Ich zweifle daran, dass Digitalisierung irgendwas mit Bildung zu tun hat. Man braucht mehr Lehrer:innen, mehr Schulstunden, kleinere Klassen etc. - alles lange bekannt. Aber Experten fordern immer mehr Fächer (früher war es mal Chinesisch, jetzt eher Finanzen und Umwelt/Klima - so bleibt Mathe auf der Strecke.
Betr.: Ihr Symbolfoto Was mich immer wieder verblüfft, ist, dass die in den Medien gerne gezeigten Schultafeln nahezu prinzipiell so verschmutzt sind, dass sich Schmutz und Schrift kaum mehr unterscheiden lassen. Besteht da möglicherweise ein Zusammenhang zu den PISA-Ergebnissen? Leserlichkeit und Lernerfolg gehören mMn schon irgendwie zusammen. Als (ehemaliger) Lehrer an einer Grundschule hätte ich niemals zugelassen, dass das Foto einer solcherart präsentierten Tafel einer doch zuweilen kritischen Öffentlichkeit vor Augen geführt wird.
Höhere finanzielle Aufwendungen im Bildungsbereich müssen nicht dem einzelnen Lehrer dienen - ich verdiene gutes Geld. Aber es wäre sinnvoll für das Geld mehr Zeitressourcen zur Verfügung zu stellen, was bedeuten würde, dass ich einige Stunden unterrichte und dafür mehr Zeit für anderes habe - zum Beispiel für die Teilnahme an Wettbewerben oder die Begleitung sozialen oder fachspezifischen außerunterrichtlichen Engagements. Heute kann ich Dienst nach Vorschrift machen oder zulasten meiner persönlichen Zeit mich zusätzlich engagieren. Ich kann jede verstehen, die das nicht tut, weil die persönliche Grenze erreicht ist. Teurer wäre das dann eben, weil es mehr KuK für den Pflichtbereich bräuchte.
Vorsicht! Was als "Interdisziplinarität" verkauft wird, und als "Aufbrechen von Schubladen", dient in Wirklichkeit dazu, dass weniger Mathe-Lehrer*Innen benötigt werden, denn die sind Mangelware. Inhalte sollen von Lehrer*Innen anderer Fachrichtung (Gemeinschaftskunde, Erdkunde etc.) abgefangen werden. Von denen gibt es nämlich viel mehr. Was fehlt ist ein deutlicherer Schwerpunkt in Mathematik, in Naturwissenschaften, Deutsch und Englisch. Mehr Stunden in diesen Fächern! Das antiquierte "Humboldtschen Bildungsideal" mit drei Fremdsprachen ist aus der Zeit gefallen. Es werden zu viele Stunden in weitere Fremdsprache investiert. Wofür eigentlich? An den Hochschulen und Berufsschulen scheitern alle am Rechnen. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich viele Politiker*Innen selbst mit mathematischen Inhalten früher schwer getan haben und eher bla-bla-Inhalten zugeneigt waren.
Mathematiklehrer sind eine aussterbene Spezies, deren Schaffenskraft es zu ersetzen gilt. Allerdings möchte ich nicht, dass Gemeinschaftskunde- oder Sprachenlehrer anfangen, Mathemematik zu betreiben. Das möchten die vermutlich auch nicht, sonst hätten die es studiert. Mathematik ist in Schulen auf dem Rückweg. "Lesen, Schreiben und minimal Rechnen" könnte man das Fach auch nennen. Mathematik ist im Schulfach Mathematik nicht mehr viel drin. Und das bisschen Rechnen bereitet zusehens Schwierigkeiten. Auch in der von Ihnen genannten Berufsschule. Fachrechnen mit Dreisatz bei Kaufleuten ist ein Drama. Welcher halbwegs klar bei Verstand agierende Mensch wird heute noch Matematiklehrer? Jeder darf ungeniert und ungeniert mit mathematischem Analphabetismus koketteren - auch Politiker bei eine 360-Grad-Wende (Baerbock). Nur wenige outen sich mit "Deutsch konnte ich noch nie!".
Sehr geehrter Herr Prof. Hesse, vielen Dank für Ihre Vorschläge zur Verbesserung des Mathematikunterrichts des Landes Baden-Württemberg. Gestatten Sie mir eine Frage? Ja? Wann waren Sie zum letzten Mal in einer Gemeinschafts- oder Realschule im Mathematikunterricht? Kennen Sie die Realität oder denken Sie nur über Veränderungen derselben im Elfenbeinturm nach? Schauen Sie mal die Abituraufgaben der letzten Jahre an, welche irrigen Phantasien und wahnwitzigen Aufgaben durch den "Anwendungsbezug" im Zusammenhang mit der Kompetenzorientierung entstanden sind. Textleseverständnis statt Mathematik. Eine Aufwertung des Lehrerberufes durch eine höhere Bezahlung ist nicht zielführend. Mehr Wertschätzung und Anerkennung durch eine bessere Behandlung, durch eine gerechteArbeitszeiterfassung und durch Pausen- und Erholungsräume wären die besseren Alternativen. Vielen Dank für Ihr offenes Ohr!