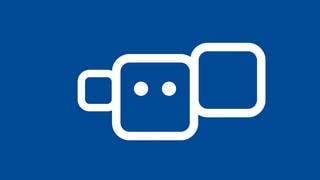Es ist viel passiert seit #Metoo. Viel ist geredet worden, manches getan, einiges neu gedacht. Ging es zunächst um sexuelle Belästigung und Übergriffe, wurde daraus bald eine große Debatte über Machtmissbrauch und Gleichberechtigung. Verhaltens- und Redeweisen, die vorher alle für normal hielten, sind jetzt nicht mehr stubenrein.
Dennoch: Wir stehen immer noch am Anfang – und das in Deutschland schon seit mindestens 70 Jahren, als der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ im Grundgesetz verankert wurde. 2019 gibt es hierzulande einen Gender-Pay-Gap von 21 Prozent, einen der höchsten unter den Industrieländern. Wir haben eine Kanzlerin, aber weniger als ein Drittel der Abgeordneten im Bundestag sind Frauen. Auf den 12 Intendantinnensesseln der deutschen Rundfunkanstalten sitzen zwei Frauen. Und so weiter. Im Grunde kennen wir alle die Zahlen und den Befund. Und auch die vielen, komplexen Gründe dafür.
„Frauen im Ausschnitt“ hat den Blick auf die blinden Flecken gelenkt, die wir alle immer noch haben – Männer wie Frauen. Und auf die weißen Flecken der Karte, die wir noch nicht entdeckt haben, die aber schon besiedelt sind von anderen Lebens- und Umgangsformen – feministischen Utopien, alternativen Netzwerken, kooperativen Arbeitsweisen. Und natürlich auf die Sprache, in der wir streiten und über die wir streiten müssen. Die immer als Übersetzerin zwischen uns und der Wirklichkeit steht. Aber auch immer in Bewegung ist.








Was passiert in unseren Köpfen, wenn das generische Maskulinum durch ein nicht weniger generisches Femininum ersetzt wird? Wenn in einem Hörspiel, einem Film, einem Roman jede männliche Figur in eine weibliche verwandelt wird? Oder wenn nur Frauen in der Jury oder auf dem Panel sitzen? Ist das erhellend? Merkwürdig? Einseitig? Höchste Zeit? Oder vielleicht schlichtweg egal?
Probieren wir es doch einfach mal aus. Und beobachten wir uns doch mal wenigstens einen halben Tag lang selbst, Frauen und Männer, wie oft wir in generischen Mustern nicht nur sprechen, sondern auch agieren.