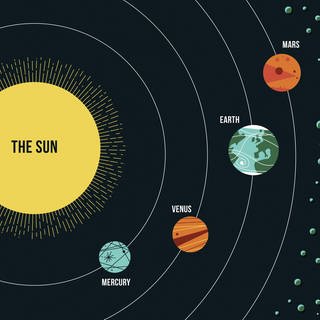Das ist eine sehr schöne Frage, denn in Italien sagt man: "Mi sembra tedesco" – "das kommt mir Deutsch vor" und das heißt: unverständlich. In Spanien gibt es die "Cuentos chinos", das sind Lügenmärchen. Und wir sagen manchmal: "Das ist Fachchinesisch für mich".
König Karl V. und sein spanischer Hofstaat
Es geht in diesen Redewendungen darum, dass eine fremde Sprache einem seltsam vorkommt. Beim Spanischen kommt etwas ganz Besonderes dazu: 1519 wurde nämlich Karl als Karl V. zum römisch-deutschen König gewählt. Er war bereits König von Spanien, brachte also von dort seinen ganzen Hofstaat mit. Das erschien den deutschen Fürsten seltsam – was die für Gebräuche hatten, wie die sich miteinander unterhielten, was die miteinander so alles machten! – So haben sie gesagt: "Das kommt mir Spanisch vor".
Aber auch Karl war nicht so sehr höflich mit den Deutschen, er sagte: "Mit meinem Gott spreche ich Latein, mit meinen Großen spreche ich Spanisch und mit meinem Pferd spreche ich Deutsch.“ Da war das Deutsche also die unterste Sprachstufe.
Karl V., ein Habsburger, ist also dafür zuständig, dass wir sagen: Das kommt mir merkwürdig vor.

Redewendung Woher kommt die Redewendung "Wes Brot ich ess, des Lied ich sing"?
Minnesänger zogen früher von Hof zu Hof, um mit Singen für ihren Unterhalt zu sorgen. Und da war es besser, den Grafen oder Fürsten, dem der Hof gehörte, nicht zu verärgern. Von Rolf-Bernhard Essig
Sprichwörter und Redensarten
Redensart Sich "wie ein Schneekönig" freuen – Woher kommt das?
Schneekönig ist ein anderer Name für den Zaunkönig. Weitere Bezeichnungen sind Tannkönig, Meisenkönig und bei den alten Griechen Königlein.