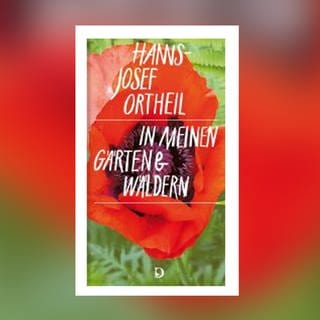Wie einen Todestunnel erlebt Hanns-Josef Ortheil die kritische Phase nach einer gefährlichen Operation. Als er langsam wieder zu Kräften kommt, steht das Leben in Frage. Alles muss neu erlernt werden. Davon erzählt der im November 70 werdende Autor in „Ombra“, seinem „Roman einer Wiedergeburt“.
Ein Stück Rekonvaleszenzliteratur
Unter den Krankheitsromanen und -tagebüchern gibt es das Sub-Genre der Rekonvaleszenzliteratur: Ein Autor oder eine Autorin kämpft sich darin zurück ins Leben und ins Schreiben. Kathrin Schmidts seinerzeit mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneter Roman „Du stirbst nicht“ verhandelte die Folgen eines Schlaganfalls, der die Schriftstellerin mit Mitte 40 ereilt hatte. Friedrich Christian Delius erzählt in dem essayistischen Memoire „Lebensanzeige oder Die Stimmlosigkeit der Stimmbänder“ von einer Virusinfektion, die ihn fast das Leben gekostet hätte.
Das jüngste Rekonvaleszenz-Werk legt nun Hanns-Josef Ortheil vor. „Ombra“ trägt die Gattungsbezeichnung „Roman einer Wiedergeburt“. Roman meint hier eher das Romanhafte des Geschilderten, das Unglaubliche, vielleicht auch Epiphanische daran. Denn was dem Ich-Erzähler im Buch widerfährt, hat der Autor vor zwei Jahren selbst erlebt:
„Mein Hirn ist durcheinander, und ich weiß nicht, wie ich Ordnung hineinbringen könnte. Die Herz-Operation liegt erst einen Monat zurück. Sie dauerte fünf Stunden, und danach lag ich im Koma, aus dem ich fast nicht mehr erwacht wäre.“ (Hanns-Josef Ortheil)
Den „Todestunnel“ – wie Ortheil schreibt – hatte er da schon betreten. Und wurde doch noch einmal zurückgeholt. Geblieben ist eine tiefe Erschütterung, die Angst, dass jederzeit etwas mit diesem fragilen Ich geschehen könnte, dass es ganz auseinanderbricht. Der leidenschaftliche Klavierspieler schafft es nicht mehr, linke und rechte Hand zu koordinieren. Der Schriftsteller bringt nicht einmal einen geraden Satz aufs Papier.
„Ich fühle mich hilflos und amputiert.“
Das ist der absolute Worst Case für einen wie Hanns-Josef Ortheil. Denn dieser Autor ist sozusagen die Joyce Carol Oates des deutschen Literaturbetriebs, zumindest was die Produktivität angeht. Wie Oates mit ihren unzählbaren Romanen ist auch Ortheil ein Vielschreiber vor dem Herrn. 70 Bücher in 70 Lebensjahren, von den aberhundert sonstigen Texten für Zeitschriften und Zeitungen ganz zu schweigen. Selbst wenn er dereinst einmal nicht mehr unter uns weilen sollte, dürfte man trotzdem nicht vor einem neuen Buch von ihm sicher sein – er würde Mittel und Wege finden, ein Werk aus dem Jenseits heraus zu veröffentlichen.
Bei Ortheil hat das Schreiben etwas Manisches. Es gehört zum Leben wie das Atmen, es ist ein automatischer Vorgang. Das hat freilich auch einen Haken. Wenn bei einem Menschen wie Ortheil die Massen-Produktions-Maschine aussetzt, gerät das ganze Selbstverständnis in Gefahr.
Diese Verunsicherung ist das Zentrum seines neuen Buches: Ein Mann, der die besten Jahre schon überschritten hat, auch wenn er sich noch für einen Jungspund und Energiebolzen hält, soll plötzlich Yoga machen, statt Klavier zu spielen. Er soll nach Walkingstöcken greifen statt nach dem Bleistift. Und dann auch noch ein psychotherapeutisches Angebot in Anspruch nehmen, statt Gespräche mit den Intellektuellenfreunden zu führen. Das kann einen schon mitnehmen und Fragen aufwerfen:
„Was zum Teufel waren die Ursachen und Hintergründe der sich heimlich und hinterrücks anschleichenden Erkrankung?“ (Hanns-Josef Ortheil)
Diesen Hintergründen will er auf unterschiedlichste Weise auf die Spur kommen. Ortheil respektive sein Held registriert den neuen Zustand zunächst niedergeschlagen, dann mit größer werdendem Interesse, und diesen Prozess des Zurückfindens und des Erkenntnisgewinns protokolliert er in „Ombra“ – das italienische Wort steht übrigens für den Schatten, den Verdacht, den Zweifel ebenso wie für ein Glas Wein, das man als Aperitif zu sich nimmt: Ortheils Alter Ego gibt den Musterpatienten, obwohl ihm beim Treppensteigen der Schweiß ausbricht. Er nimmt Hausaufgaben und gute Ratschläge mit nach Hause. Er will es ruhiger angehen lassen und eröffnet dann doch in bedenklichem Gesundheitszustand eine Art Gedenkmuseum für sein Werk und seine Familiengeschichte in seinem Kindheitsort im Westerwald.
Kleine und größere Ereignisse sind Teil des „Kampfes um das Weiterleben“
Langsam, ganz langsam kehrt er in seine Welt zurück – in seine Kindheit in Köln-Nippes. Aber selbstverständlich auch in die der Literatur, der Kunst, der Musik. Und des Literaturbetriebs. Eine große Lesung aus seinem jüngsten Buch über Ernest Hemingway im Funkhaus des WDR ist für den von Gefallsucht nicht ganz freien Autor eine Wiedergeburt: Vor hunderten Zuhörern – darunter macht er es nicht – findet er langsam zu seiner Vorlesestimme. Und triumphiert nach bestandener Prüfung.
„Ich werde angesprochen und befragt und sogar gefeiert. Sie sind wieder der Alte! Niemand liest so gut wie Sie! Was für ein kluges Gespräch, ich werde meiner Nichte davon berichten, die liest alle Ihre Bücher! – Vielen Dank, großen Dank, meinen besten Dank! (…) Das Signieren dauert mehr als eine Stunde, und danach weiß ich nicht mehr, wie viele Gläser ich getrunken habe. Ich spüre einen ekstatischen Rausch, wie ich lange keinen mehr erlebt habe. Die Lesung als dionysisches Fest, das in befreienden, erlösenden Tänzen ausklingt!“ (aus: „Ombra“)
Die Welt und das Schicksal meinen es also wieder gut mit Dionysos: Vom Personal der Reha-Klinik wird er rasch als Schriftsteller entlarvt; mit der griechisch-stämmigen Chefärztin tauscht er sich über seine Jugendreise nach Griechenland aus (den Reisebericht des 15-Jährigen, ebenfalls als Buch erschienen, liest sie selbstverständlich bis zur nächsten Konsultation). Auch die Therapeutin kann dann nicht widerstehen und beschäftigt sich mit seinem Werk. Der herzschwache Patient mutiert zu einer Art Goethe, zumindest in dieser Klinik – der große Dichterstar im Krankenstadl.
Ein paar Mal zu oft kokettiert der Erzähler mit seiner Bedeutsamkeit
Das kann ein wenig auf die Nerven gehen. Wie überhaupt die Beschreibungen der verschiedenen Therapiesitzungen, die imaginierten Gespräche mit Übervater und Übermutter, in die sich immer wieder Sigmund Freud einschaltet, die tiefschürfenden Erkundungen des eigenen literarischen Werdegangs, die nur mühsam hinter Selbstironie versteckte Selbstbeweihräucherung dieses ambulanten Reha-Klienten auf Dauer etwas ermüden.
Hier zeigt sich vielleicht noch einmal deutlich das Problem des Ortheilschen Werks insgesamt: Viel zu schreiben heißt ja nicht automatisch, große Literatur hervorzubringen. Wer aber davon überzeugt ist, dass noch jedes Schnipselchen seines Tuns und jeder Gedanke nicht nur den Weg aufs Papier finden muss, sondern auch in die Öffentlichkeit (einen Blog bespielt der echte Ortheil auch noch), der steht am Ende halt mit Händen voller Bücher dar. Und zuletzt noch mit einem Genesungsroman, der auf ein Minimum eingedampft erträglich, ja sogar berührend hätte sein können. So aber doch voller Längen ist. Und voller Eitelkeiten, die nur notdürftig hinter der Erzählerfassade verborgen werden.
Dennoch: Für den Autor Ortheil ist „Ombra“ vielleicht eines seiner wichtigsten Bücher, weil es ihm einen Weg aus dem „Todestunnel“, aus der Katastrophe der Todeserfahrung gewiesen hat. In diesem Sinne muss man Ortheil Anerkennung zollen für seine Disziplin und Unermüdlichkeit. Und sich am Ende freuen, dass zu seinem 70. Geburtstag am 5. November nicht nur „Ombra“ auf dem Gabentisch liegt, sondern darüber hinaus auch noch ein Jubelband mit dem doch sehr bezeichnenden Titel „Der Kosmos der Schrift“.
Zeitgenossen Hanns-Josef Ortheil: „Eigentlich bin ich ja mein eigener Therapeut“
In einer tieftraumatisierten Familie lernte Hanns-Josef Ortheil das Schreiben vor dem Sprechen, Musik war die Sprache zwischen ihm und der stumm gewordenen Mutter. Über 70 Bücher über das Leben, die Kunst und den Genuss hat der Autor geschrieben.
Hanns-Josef Ortheil Die Mittelmeerreise
Hanns-Josef Ortheil erzählt von einer großen Mittelmeerreise mit seinem Vater. Es ist 1967 – während seine Altersgenossen demonstrieren, wird der junge Hanns Josef Ortheil zum Schriftsteller.| Luchterhand Verlag, 640 Seiten, 24 Euro.| Rezension von Michael Au.
Literatur Hanns-Josef Ortheil: „In meinen Gärten und Wäldern“
Seit seiner Kindheit gehört das genaue Beobachten und tägliche Notieren zum Alltag des Schriftstellers Hanns-Josef Ortheil. Das Buch „In meinen Gärten und Wäldern“ zeigt erneut, wie dabei Literatur entsteht: Inspiriert von Gartenstreifzügen kombiniert er spontane Fotos mit ausgefeilten Texten in der Tradition französischer Prosagedichte. Ein poetisches Werk, das zeigt, welche Schönheit im kleinsten Winkel unseres Alltags zu entdecken ist.