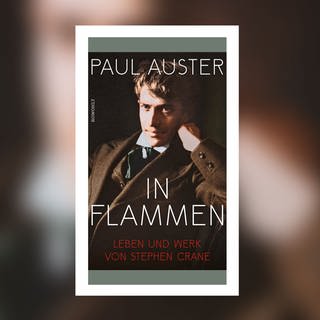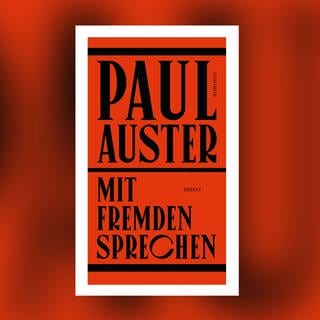Wie weiterleben nach dem Tod eines geliebten Menschen? Paul Austers „Baumgartner“ ist ein schmaler Roman über Verlust, Trauer, Liebe und Schreiben – und über die kleinen Dinge, die uns trotz allem durchhalten lassen.
Es gibt zwei Sätze in Paul Austers neuem Roman „Baumgartner“, die auf den Punkt bringen, worum es in diesem Buch geht:
„Sie fehlt mir, das ist alles. Sie war die Einzige auf der Welt, die ich jemals geliebt habe, und jetzt muss ich herausfinden, wie ich ohne sie weiterleben kann.“
Wie weiterleben, wenn jemand gestorben ist, der so wichtig war? Mit dem ein Teil des eigenen Lebens für immer verschwunden ist? Irgendwie drüber wegkommen, möglichst bald abschließen und nicht zurückblicken?
Dieses nicht nur in den USA immer beliebter werdende Konzept scheint untauglich für Austers Titelhelden, den verwitweten Philosophieprofessor S. T. Baumgartner. Und trotzdem beginnt das Buch mit einer Kette slapstickhafter Szenen. Alles geht schief an diesem Frühlingsmorgen des Jahres 2018.
Ein verbrannter Topf löst Erinnerungen aus
Auf dem Gasherd verschmurgelt ein Aluminiumtopf, an dem Baumgartner sich die Hand verbrennt. Die kleine Tochter des Gärtners ruft an und erzählt, ihr Vater habe sich versehentlich zwei Finger abgesägt. Schließlich stolpert Baumgartner noch auf der Kellertreppe und bricht sich fast die Knochen.
Zum Glück ist der Zählerableser da, der sich rührend um ihn kümmert. Und zum Glück war die Paketbotin da, in die er ein bisschen verknallt ist, weshalb er immer wieder Bücher bestellt, die er gar nicht haben will.
Kaum hat Baumgartner sich nach seinen Missgeschicken halbwegs berappelt, setzen, wie es so ist, wenn man die siebzig hinter sich gelassen hat, die Erinnerungen ein: an die erste Begegnung mit seiner späteren Frau Anna in Manhattan, beim Kauf des nun verschmurgelten Aluminiumtopfs, beide blutjung und bitterarm, vor fünfzig Jahren …
… und sein wahres Leben begann, sein einzig wahres Leben, das währte, bis sie vor neun Sommern in die Brandung vor Cape Cod stürmte und in die verhängnisvolle Monsterwelle geriet, die ihr das Rückgrat brach und sie tötete, und seit diesem Nachmittag, seit diesem Nachmittag – nein, sagt sich Baumgartner, da musst du jetzt nicht hin, du erbärmlicher Versager, lass das, hör auf, diesen Topf anzustarren, Idiot, oder ich erwürge dich mit meinen eigenen zwei Händen.
Dass „Baumgartner“ mitnichten ein todernstes, sondern teilweise sehr komisches Buch geworden ist, liegt an der Hauptfigur, in deren Hirn Paul Auster seine Leserschaft entführt. Dieser Professor für Phänomenologie in Princeton tendiert zwar durchaus in Richtung grumpy old man und fühlt sich auch so, mit Geschlurfe und Geächze und versehentlich nicht geschlossenem Hosenstall, und der Verlust der geliebten Frau ist tatsächlich nicht zu überwinden.
Zugleich aber entwickelt Baumgartner immer wieder Begeisterungsfähigkeit, Hoffnung und Interesse an anderen Menschen. Er nimmt Projekte in Angriff und schmiedet Pläne, verliebt sich sogar noch einmal, kurz, ist erfüllt von Lebenswillen. Dass einige dieser Pläne und Hoffnungen scheitern, tut dem keinen Abbruch. Man muss sich Seymour T. Baumgartner aus glücklichen Menschen vorstellen.
Porträt eines gewinnenden Stehauf-Mannes
„Baumgartner“ ist mit seinen kaum 200 Seiten vermutlich der schmalste von Paul Austers bisher 18 Romanen; allein das 2018 erschienene Großwerk „4321“ bringt es auf mehr als tausend Seiten. Mag sein, der ungewohnten Ökonomie des Erzählens in diesem neuen Buch liegen die Krebsbehandlungen zugrunde, denen Auster sich seit einem Jahr unterziehen muss.
Doch trotz des geringen Umfangs wirkt dieses Porträt eines ziemlich gewinnenden Stehauf-Mannes nicht etwa unvollständig, sondern lässt in geschickt montierten Szenen ein Leben in Fülle vor den Augen der Leser erstehen.
Was Baumgartner nach dem Frühlingstag 2018 geschieht, ist im Präsens erzählt, dazwischen schieben sich die Erinnerungen nicht nur an das Leben mit seiner Frau und ihren plötzlichen Tod, sondern auch an seine Kindheit und Jugend in Newark, an seine „erschöpften, abgearbeiteten“ Eltern, die Nachfahren osteuropäischer Juden waren.
Eingefügt sind zudem Gedichte und kurze autobiografische Texte aus Annas Nachlass und sogar eigene Prosa von Auster, die er hier seinem Baumgartner unterschiebt, so die an Kafka geschulte Parabel „Lebenslänglich“:
Ich war gerade siebzehn geworden, als der oberste Richter des Northern District mir sein Urteil und das Strafmaß verkündete: lebenslänglich Sätze machen. Das war vor mehr als einem halben Jahrhundert, und seitdem sitze ich allein in einer Zelle im zweiten Stock der Haftanstalt Nr. 7. Ich gebe zu, die Strafe ist hart, aber ich will den Behörden nicht unrecht tun, die Tür meiner Zelle war nie abgeschlossen, und ich zweifle kaum daran, dass ich jederzeit hätte aufstehen und davongehen können.
Ein Roman über das Weiterleben mit allem, was fehlt
So schmal der Roman ist, die Fans von Paul Auster werden darin vieles wiederfinden, was sie an ihm schätzen. Die Auster-Verächter, denn auch solche gibt es ja, können hier einen ganz unverschwurbelten, lässig-souveränen Autor entdecken.
Paul Auster serviert Referenzen und Koinzidenzen, die ihm den Ruf eines Postmodernisten eingetragen haben, Spielereien wie den Schwitters-Namen Anna Blume und den vollständigen Namen des Protagonisten Seymour Tecumseh Baumgartner, in dem sämtliche Buchstaben des Autorennamens Auster gleich zweimal enthalten sind.
Es gibt unheimliche, lebensverändernde Träume, metaphysische Spekulationen, und der Held selbst passt durchaus in die Reihe der immer latent desorientierten Auster-Helden in einer plötzlich fremd wirkenden Welt.
Allerdings ist hier alles ins Leichtere, Hellere, sogar Ironische gewendet. Und zwar bis zum spannungsgeladenen Schluss, der Baumgartner und damit die Leserinnen und Leser in eine eisige Winternacht entlässt, die alles bringen kann, Gutes wie Schlimmes.
So gelingt Paul Auster ein ebenso berührender wie unterhaltsamer Roman über Trauer und Verlust, über das Schreiben und über das Weiterleben mit allem, was fehlt.
Buchkritik Paul Auster – In Flammen. Leben und Werk von Stephen Crane
Paul Auster ist fasziniert von Leben und Werk des Schriftstellers Stephen Crane und hat ihm diese Biografie gewidmet. Crane gilt als einer der Pioniere der modernen amerikanischen Literatur und wurde 1895 mit seinem Kriegsroman „Die rote Tapferkeitsmedaille“ berühmt. Ein Autor, der für’s Schreiben brannte, dessen Leben aber schon früh erlosch. Paul Austers „In Flammen“ ist eine etwas ausufernde Hommage an ihn.
Rezension von Eberhard Falcke.
Leben und Werk von Stephen Crane
Aus dem Englischen von Werner Schmitz
Rowohlt Verlag, 1184 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-498-00167-4
Gespräch Writers against Trump - Schriftsteller gegen die Wiederwahl des US-Präsidenten
Eine Gruppe von US-Autor*innen um Siri Hustvedt und ihren Ehemann Paul Auster protestiert gegen eine mögliche Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump. Die Schriftsteller*innen haben sich unter dem Namen „Writers Against Trump“ zusammengeschlossen, „um sich gegen das rassistische, destruktive, inkompetente, korrupte und faschistische Regime" von Donald Trump zu stellen.
Anja Höfer im Gespräch mit Peter Mücke, ARD-Studio New York.