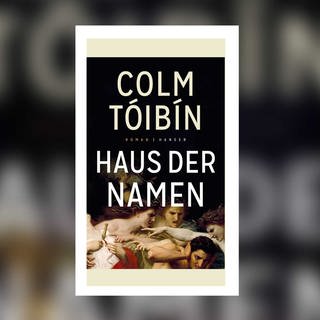War der Großschriftsteller und Literaturnobelpreisträger Thomas Mann in Wahrheit ein Außenseiter? Das ist die spannende These von Colm Tóibíns biographisch weit ausholenden Lebensroman über Mann.
In „Außenseiter“ von Hans Mayer ist Thomas Mann einer der erfolgreichen Repräsentanten seiner Zeit
1975 veröffentlichte der Suhrkamp Verlag ein Buch, das einem die Augen öffnete für die Widersprüche der bürgerlichen Aufklärung, die gleiches Recht für alle versprach, aber in Wirklichkeit davon lebte, bestimmte Stimmen nicht zu Wort kommen zu lassen, sondern sie unter Stereotypen zu begraben. Es ging um Frauen, um Schwule, um Juden.
Das Buch hieß „Außenseiter“ und geschrieben hatte es einer der Stars der deutschen Intellektuellenszene: Hans Mayer, selbst schwul, selbst Jude. In diesem Buch kommt Thomas Mann natürlich vor, aber eben nicht als einer, der nicht dazugehört, sondern als einer der erfolgreichen Repräsentanten seiner Zeit.
Bei Colm Tóibín ist der deutsche Literaturnobelpreisträger Thomas Mann ein Außenseiter
Im neuen Roman des irischen Schriftstellers Colm Tóibín lernen wir etwas ganz anderes. Wir lesen ein Porträt des deutschen Literaturnobelpreisträgers als Außenseiter. Manns Homosexualität, die er zeitlebens hinter der Familienfassade verborgen hat, ist dabei nur eine der vielen Fremdheitserfahrungen, aber vielleicht doch der entscheidende Riss, der schon den jungen Thomas für immer von seinen Mitmenschen trennt und erst den gnadenlosen und kalten Blick auf die Zeitgenossen ermöglicht, der dann den Schriftsteller Thomas Mann auszeichnet.
Doch schon die brasilianische Mutter macht Thomas zu einem Außenseiter im protestantischen Lübeck. Dann der Absturz, der Vater stirbt, der Umzug nach München. Plötzlich gehört man nicht mehr der besten Gesellschaft an. Man bestaunt von außen die Pringsheims, in deren Familie Thomas einheiraten wird, ohne jemals einer von ihnen zu sein. Er bleibt Provinz.
Manns „Betrachtungen eines Unpolitischen“ sind 1918 hoffnungslos aus der Zeit gefallen
In der Münchner Revolution nach dem Ersten Weltkrieg entgeht er nur knapp der Gefangennahme. Seine politisch-konservative Streitschrift „Betrachtungen eines Unpolitischen“ ist, als sie 1918 erscheint, hoffnungslos aus der Zeit gefallen.
Aus der Zeit fallen, Isolation, das ist auch das Thema seines „Zauberbergs“. Als Thomas Mann 1930 gegen Hitler anschreibt, appelliert er an ein humanes Bürgertum, das nicht existiert, während die entschiedenen Hitlergegner sich am Gegensatz von Sozialdemokratie und Sozialismus aufreiben.
Tochter Erika drängt Thomas Mann zu einer deutlichen Stellungnahme gegen die Nazis
Nach der Machtergreifung zögert er lange, sich gegen die Nazis auszusprechen, weil er um seinen Besitz, seine Schwiegereltern, aber eben auch um seine Veröffentlichungsmöglichkeiten in Deutschland fürchtet.
Erst seine Tochter Erika treibt ihn zu einer deutlichen Stellungnahme. Dann die Jahre im Exil: Nirgends ist er ganz zuhause, nicht in der Schweiz, nicht in Princeton, nicht in Kalifornien. Mal ist er zu reich, mal zu erfolgreich, mal zu bürgerlich, mal zu links.
Nach dem Krieg hofiert man ihn in Deutschland und wirft ihm zugleich vor, nichts von den Bombennächten zu wissen. Spätestens mit seiner Reise in die Ostzone ist auch das Amerika des Kalten Kriegs für ihn verloren.
Die biografischen Details drohen Tóibíns erzählerische Fantasie zu verschlingen
Alles das ist der Stoff für Colm Tóibíns Thomas-Mann-Roman „Der Zauberer“. Der erzählerische Aufwand, den er betreibt, ist enorm. Er lässt wenig aus, sein Ziel scheint Vollständigkeit zu sein. Dies geht auf Kosten des Innenlebens, des erzählerischen Atems. Die Biografie droht die Fantasie zu verschlingen, das Archiv die Kreativität.
Die Welt als Begehren und Bedrohung, so könnte man Thomas Manns Position beschreiben. Es ist Katia, seine Frau, die den Laden zusammenhält. Colm Tóibíns Thomas Mann ist eigentlich ein nicht ganz lebensfähiger, linkischer Intellektueller, ein Außenseiter, der die patente Frau gefunden hat, die das System Mann perfekt ergänzt. Er wird mit Sympathie geschildert.
Was Tóibín in seinem Buch über Henry James gelang, gelingt ihm hier bei Thomas Mann nicht
Weniger erfährt man vom Monster Thomas Mann, der seine Familie tyrannisiert, weniger auch vom titelgebenden „Zauberer“, also von dem, was ihn zum Zauberer gemacht hat: seine Prosa. Nur bei den früheren Büchern gelingt die Verknüpfung von Werk und Leben, beim „Tod in Venedig“, beim „Zauberberg“.
Zumeist schildert Colm Tóibín den Autor Thomas Mann, wenn er nicht künstlerisch tätig ist. Obwohl er in seinem wunderbaren Buch „Das Porträt des Schriftstellers in mittleren Jahren“ über Henry James bewiesen hat, wie das geht, über dichtende Dichter schreiben. Denn im Innenleben, im Selbstgespräch vereint sich beides, die Gedanken über die Welt und das Schreiben über diese Gedanken. Hier, im neuen Roman, hat sich die Welt, wenn man so will, selbständig gemacht.
Am besten ist Colm Tóibín in den Dialogszenen von Thomas Mann mit Katia und den Kindern
Am besten ist Colm Tóibín, wenn er sich frei fühlt von diesen Pflichtaufgaben, wenn er nicht schwer an der Biographie und der Zeitgeschichte trägt. Und das gelingt vor allem in den Dialogszenen mit Katia und den Kindern. Äußerst komisch sind die mit Elisabeth, die dem verdutzten Vater von der Heirat mit einem Mann erzählt, der nahezu so alt ist wie er selbst.
Ähnlich gelungen ist der Auftritt des schwulen Erika-Gattens W. H. Auden und dessen Freund Christopher Isherwood, dann die spannenden Szenen zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, später die berührende Trauer um den verlorenen Sohn Klaus.
Am Ende seines Romans greift Colm Tóibín ein früheres Motiv wieder auf. Der junge Thomas hält sich für einen Hochstapler, der alte ebenso. Darum schreibt er „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“. Beide, der junge und der alte, wissen, sie gehören nicht dazu. Das macht ihren Erfolg für sie so rätselhaft.
Wer bin denn ICH? ist die eigentliche Frage dieses Romans
Hochstapler durchschauen die Welt, aber nicht sich selbst. Darum ist die bohrende Frage: Wer bin denn ICH? die eigentliche dieses Romans. Seine Stärke liegt gerade darin, sie nicht endgültig beantworten zu wollen. Seine Schwäche, dass er dafür ein ganzes erzähltes Leben braucht.
Buchkritik Colm Toibin - Haus der Namen
König Agamemnon hat seine Tochter den Göttern geopfert und wird dafür von seiner Frau Klytaimnestra ermordet. Sohn Orestes gerät zwischen alle Fronten. Colm Toibin erzählt das blutige antike Drama als Studie einer kaputten Familie. Uralter Stoff, aber hochaktuell!
Rezension von Theresa Hübner.
Hanser Verlag
ISBN: 978-3-446-26181-5
288 Seiten
24 Euro