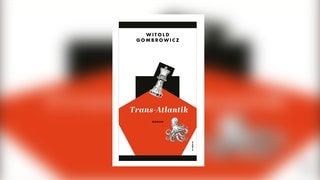„Trans-Atlantik“, 1953 erstmals in Polen erschienen, ist nach „Ferdydurke“ Witold Gombrowiczs zweites Meisterwerk: eine Satire auf patriotisches Denken, ein avanciertes Spiel mit dem Grotesken und ein urkomisches Selbstporträt des in Argentinien gestrandeten Autors.
Im August 1939 begibt sich der Autor Witold Gombrowicz auf einem Transatlantikliner auf die Reise nach Buenos Aires. Die Rückfahrkarte, ausgestellt auf den 1. September, lässt er allerdings verfallen. An diesem Tag begann bekanntlich der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff Nazideutschlands auf Polen. Gombrowicz bleibt für die nächsten 24 Jahre in Argentinien.
Mit dieser autobiographischen Episode beginnt sein dritter Roman „Trans-Atlantik“, 1953 im Original und 1963 auch auf Deutsch erschienen. Der Roman „Ferdydurke“ aus dem Jahr 1938 hatte Gombrowicz bekannt gemacht, ein „Geniestreich“, wie der Übersetzer und Herausgeber Rolf Fieguth schreibt, aber eben kein einmaliger. Denn mit „Trans-Atlantik“, hochliterarisch wie der Vorgänger, habe er seinen Ruhm in der polnischen Literatur endgültig gefestigt.
Rolf Fieguth:
„Schlüsselroman, skandalisierende Satire, moral-humoristischer Traktat, doch zugleich und vor allem ist es das unbedingtere und auch geschlossenere Sprachkunstwerk, in welchem die artistische Fantasie, der Rausch, der Traum und die Schönheitssehnsucht inmitten aller Ekelhaftigkeit triumphieren.“
Balancieren auf verschiedenen Bedeutungsebenen
Aber wie es mit solch epochemachenden, dem Realismus nicht zugeneigten Werken zuweilen ist: Sie müssen ihren Weg auch zu nachgeborenen Lesern finden. Mit der Wiederveröffentlichung der 37 Jahre alten Hanser-Ausgabe im Kampa Verlag ist ein erster Schritt getan. Allerdings sollte man nicht erwarten, dass es einem der Text selbst ganz einfach macht, denn was Fieguth als hochliterarisch bezeichnet, deutet schon hin auf den Anspielungsreichtum, die sprachspielerische Lust, das Balancieren auf verschiedenen Bedeutungsebenen.
Die angesprochene moralisch-humoristische Dimension aber lässt sich leicht erkennen. Als der Titelheld, der den Namen des Autors trägt, in seinem Exil in Geldnöte gerät und seine polnischen Landsleute inklusive Minister anpumpt, ist das nicht ohne bitterernsten Witz.
Gut gut, hier hast du 70 Pesos, (…).« Ich sehe also, dass er mich mit Geld abspeist; und nicht einfach mit Geld, sondern mit Kleingeld! Nach einer so schweren Beleidigung steigt mir das Blut in den Kopf, ich sage aber nichts. Ich sage erst: »Ich sehe, ich muss dem Hochwohlgeborenen Herrn sehr klein sein, denn Ihr speist mich auch mit Kleingeld ab, und sicher zählt Ihr mich unter die Zehntausend Literaten; aber ich bin nicht nur Literat, sondern auch Gombrowicz!
Er fragt: »Was für ein Gombrowicz?« Ich spreche: »Gombrowicz, Gombrowicz.« Er rollt das Auge und spricht: »Wohlan, wenn du Gombrowicz bist, so hast du hier 80 Pesos (…).“
Schelmische Naivität
Das Spiel mit Paradoxien, Übertreibungen, Wiederholungen, Absurditäten und den umgangssprachlichen Plauderton, der diesen Roman prägt, kann man hier schon bemerken. Damit sollen einerseits der Gestus des mündlichen Erzählens, andererseits die primitivistischen Sprachdeformationen der historischen Avantgarden nachvollzogen werden.
Auch der Rückgriff auf vormoderne Erzählungen wie den „Simplicissimus“ liegt Gombrowicz nicht fern. Das hat freilich einen höheren Zweck: Mit einer schelmischen, demaskierenden Naivität schlägt sich sein Held nicht nur mit seinen polnischen Landsleuten, sondern auch dem polnischen Nationalstolz herum, der hier satirisch verunstaltet wird.
Wie Gombrowicz in einem der zahlreichen Vorworte zu seinem Buch schreibt, stellt er dem gängigen idyllischen Menschenbild sein eigenes gegenüber: Die Welt sei geprägt von Fiktion und Lüge. Von Wahrhaftigkeit keine Spur. Stattdessen sind wir konfrontiert mit der Leere des Menschen – das Wort „leer“ fällt häufig in diesem Roman. Sie steht der Tiefe entgegen, die man dem menschlichen Wesen gerne zubilligen würde. Tragisch und albern ist er stattdessen.
Zum bösen Scherz oder heiteren Ernst des Buches gehört dementsprechend sein Schluss: „Da wummt das Lachen!“, heißt es auf der letzten Seite. Mit befreiendem, wummerndem Lachen endet dieser Roman einer Katastrophe, der den Autor Witold Gombrowicz auf die weltliterarische Landkarte gesetzt hat.
Mehr von Witold Gombrowicz
Mehr Literatur aus dem Polnischen
Buchkritik Olga Tokarczuk – Empusion. Eine natur(un)heilkundliche Schauergeschichte
Ein bedeutender Kurort in Schlesien, eine misogyne Männerrunde kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs und unheimliche Todesfälle: Das sind die Ingredienzien von „Empusion“, des neuen Romans der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuks, der auf raffinierte Weise mit Thomas Manns „Zauberberg“ in Dialog tritt.
Rezension von Ulrich Rüdenauer.
Aus dem Polnischen von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein
Kampa Verlag, 384 Seiten, 26 Euro
ISBN 978-3-311-10044-7
Buchkritik Szczepan Twardoch - Demut
Die Schutzlosigkeit des Einzelnen angesichts großer historischer Umwälzungen - das ist das beherrschende Thema des polnischen Autors Szczepan Twardoch. In "Demut" erzählt er in drastischen Bildern von einem Mann, der verzweifelt versucht, seine einfache schlesische Herkunftswelt hinter sich zu lassen. Aber er scheitert in den Wirren der neuen Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs.
Rezension von Holger Heimann.
Aus dem Polnischen von Olaf Kühl
Rowohlt Berlin, 464 Seiten, 25 Euro
ISBN 978-3-7371-0121-9
Buchkritik Seweryna Szmaglewska - Die Frauen von Birkenau
Eines der ersten Bücher über Auschwitz ist nach fünfundsiebzig Jahren erstmals auf Deutsch erschienen: Seweryna Szmaglewskas "Die Frauen von Birkenau". Es ist die längst fällige Wiederentdeckung eines Klassikers der Lager-Literatur.
Rezension von Wolfgang Schneider.
Aus dem Polnischen und mit einem Nachwort von Marta Kijowska
Schöffling & Co., Frankfurt 2020, 456 Seiten, Abb., geb., 28 Euro
ISBN 978-3-89561-536-8