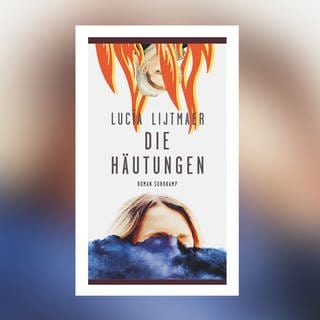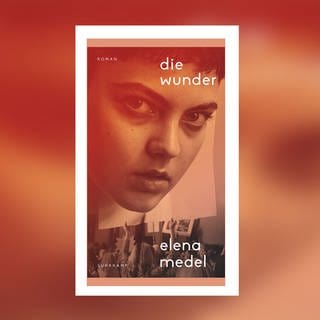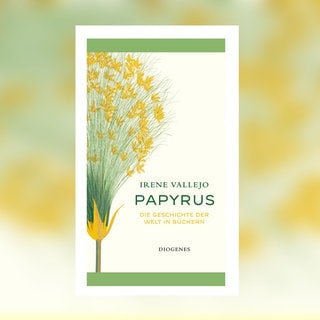Ein englisches Ehepaar kommt nach Nordspanien, denn der Mann soll dort einen Preis erhalten. Das Wiedersehen mit spanischen Freunden gerät zu einem Treffen mit Hindernissen. Der schöne Schein der Normalität und der manchmal schmale Grat zwischen Kunst und Wahnsinn - darum geht es in dem Debütroman „Die Unordentlichen“ der Spanierin Xita Rubert.
Die 17-jährige Virginia begleitet ihren Vater Juan bei einer kurzen Reise von Madrid in den Norden Spaniens. Der Anlass: ein Wiedersehen mit Juans englischem Studienfreund Andrew und dessen Familie. Andrew Kopp ist Wissenschaftler und soll in Spanien mit einem Preis geehrt werden, zur Verleihung wird sogar das Königspaar erwartet. So weit, so gut – es könnte ein angenehmes Treffen von Intellektuellen mit Sekt, Häppchen und gepflegten Gesprächen werden. Doch von Anfang an verspürt Virginia, die Ich-Erzählerin in Xita Ruberts Romans Die Unordentlichen, ein eigenartiges Unbehagen. Die Begegnung mit Familie Kopp hat eine seltsame Schwere. Bei Andrews Frau Sonya etwa nimmt Virginia eine irritierende Feindseligkeit wahr. Obwohl die beiden Frauen in dem Roman kaum interagieren, ist Virginia von der distanzierten Sonya auf eigentümliche Weise besessen, fühlt sich von ihr zugleich angezogen und abgestoßen.
Ein seltsam schwerer Sommerurlaub in Nordspanien
Und dann ist da noch der rätselhafte Bertrand, der das englische Ehepaar begleitet. Dass er der erwachsene Sohn der Kopps ist, erfährt Virginia und erfahren deshalb auch wir Leser nicht sofort. Die Kopps reden ganz offensichtlich nicht gern über Privates. Auch nicht darüber, dass Bertrand unter einer geistigen Beeinträchtigung leidet – was für Virginia und ihren Vater allerdings offensichtlich ist.
Es war nicht das Gesicht von jemandem mit Down-Syndrom; er hatte auch nicht den Blick, die Ticks der Autisten, die ich kannte, aber irgendetwas Ungewöhnliches lag in der Rundung seines Kinns und vor allem der Stirn. (…) Auch die Nase war kugelig, geradezu tierisch. (…) Das einzig wirklich Beunruhigende, was mich verstörte, (…) war die Trennung von seiner Umgebung und seine endlose, enorme, erschreckende Fröhlichkeit.
Krankheit oder Kunst?
Virginia fühlt sich von Bertrand und dessen sinnentleerten Sätzen herausgefordert. Mal ist sie fasziniert, mal verstört, mal will sie für Bertrand da sein, mal vor ihm fliehen. Letzteres vor allem dann, wenn Bertrands wirre Fröhlichkeit mal wieder in Ekstasen umschlägt, die mit physischer Gewalt einhergehen. Unterdessen tun Andrew und Sonya Kopp so, als wäre ihr Sohn gar nicht geisteskrank, sondern ein Künstler. Sie erzählen von den Skulpturen, die er erschafft, und bezeichnen seine Anfälle als Performances. Die Autorin beschreibt in ihrem Roman Upper Class-Intellektuelle, die eine Fassade von vermeintlicher Normalität aufrechterhalten, indem sie sich teils gleichmütig, teils frivol und exzentrisch geben, nie jedoch über das Wesentliche reden.
Für Virginia aber ist Krankheit ein wesentliches Thema. Auf die Tage mit den Kopps schaut sie erst viele Jahre später zurück, in der Zwischenzeit ist ihr Vater an Demenz erkrankt. Als Leser erfahren wir darüber kaum etwas, aber wir können vermuten, dass Virginias Erlebnisse mit Bertrand etwas vorwegnehmen, das ihr späteres Leben maßgeblich prägen wird.
Das Kranke ist wie das Perverse immer gegenwärtig. Stumm wartet es darauf, aufgerufen zu werden, die Bühne betreten zu dürfen, hervorzutreten, sich zu zeigen.
Diesen Satz legt Xita Rubert ihrer Ich-Erzählerin Virginia in den Mund. Es sind solche Gedanken, bei denen man zuweilen aufhorcht. Interessant ist auch, dass die Autorin durch ihre Romanfigur Bertrand die Frage nach den Berührungspunkten von Kunst und Wahnsinn stellt.
Vieles in diesem Roman bleibt unklar
So wird in Die Unordentlichen über einiges philosophiert, allerdings bleiben viele Reflexionen in der Luft hängen und wirken unvollständig. Insgesamt überzeugt der Roman mit seiner überkonstruierten Handlung nicht. Viele Wahrnehmungen der Ich-Erzählerin erschließen sich nicht oder nur schwer. Warum etwa ist das Treffen mit den Kopps für Virginia ein solch einschneidendes, ja dramatisches Erlebnis, wie sie uns suggeriert? Warum ist sie so besessen von Sonya, dass sie an einer Stelle sogar sagt, manchmal denke und schreibe sie nur für sie? Auch die Beweggründe der Kopps bleiben im Dunkeln: Warum leugnen sie die Krankheit ihres Sohnes? Vielleicht, weil sie sie nicht ertragen? Wir können es nur erraten. Klar ist: Virginia, diese junge Frau an der Schwelle zum Erwachsensein, fühlt sich extrem unwohl mit den Kopps und ihrem krampfhaften Festhalten am schönen Schein der Normalität. Wenn Xita Ruberts Roman etwas vermitteln will, dann vielleicht dies: eine Kritik an Heuchelei und einem Mangel an Wahrhaftigkeit.
Mehr Literatur von spanischen Autorinnen
Buchkritik Lucía Lijtmaer – Die Häutungen
Zwei Frauen, die eine in Barcelona, die andere in Salem in Nordamerika. Vierhundert Jahre trennen die beiden. Davon erzählt Lucía Lijtmaer in ihrem Roman „Die Häutungen“.
Buchkritik Elena Medel – Die Wunder
Zwei Frauen aus Spaniens Arbeiterklasse, Großmutter und Enkelin. Zwei Lebenswege – mit Parallelen, aber auch großen Unterschieden. Die junge spanische Autorin Elena Medel erzählt diese verwobenen Frauenleben in ihrem Roman Die Wunder. Ein differenzierter Roman über die spanische Klassengesellschaft – und über das Leben mit wenig Geld.
Rezension von Victoria Eglau.
Aus dem Spanischen von Susanne Lange
Suhrkamp Verlag, 219 Seiten, 23 Euro
ISBN 978-3-518-43028-6
Buchkritik Irene Vallejo – Papyrus. Die Geschichte der Welt in Büchern
Die Geschichte der Entstehung des Buches ist bei der spanischen Schriftstellerin Irene Vallejo ein Abenteuerbuch mit vielen Anekdoten, dramatischen Ereignissen, menschlichen Schicksalen. Lebhaft und anspielungsreich schildert sie die Bedeutung und den Einfluss der Bücher auf Kultur, Gesellschaft und Politik. Viel, so meint Vallejo, scheint sich seitdem nicht geändert zu haben.