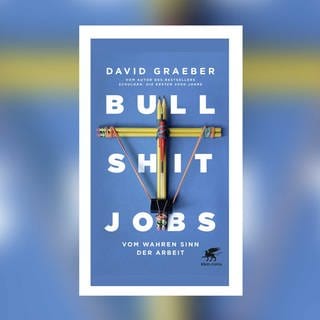In seinem Essay „Über die Arbeit“ fragt der amerikanische Philosoph Raymond Geuss danach, wie sich Arbeit als soziale Kategorie definieren lässt und wie sie sich in Zukunft verändern könnte.
Erfreulicherweise geht Raymond Geuss seinen Essay „Über die Arbeit“ nicht von der hohen Warte philosophischer Begrifflichkeit an, sondern bezieht sich, für jeden Leser verständlich, auf eigene Arbeitserfahrungen und die seines Vaters, der als Stahlarbeiter jahrzehntelang bei US-Steel tätig war.
Dieses Stahlwerk wurde 2017 abgerissen und ist insofern ein Symbol für den Strukturwandel der Arbeit, als die Bedeutung industrieller Arbeit im Vergleich zu Dienstleistungsarbeit immer mehr abzunehmen begann. Aber was heißt das für die gegenwärtige Organisation von Arbeit?
Grundlegender Strukturwandel der Arbeit
Wie verändern sich Berufe, welche Anpassungsleistungen müssen Menschen erbringen, um unter Bedingungen der Digitalisierung und der weitergehenden Globalisierung der Arbeitswelt erfolgreich zu sein? Wie sollte die Politik auf die sich rasant verändernde Ökonomie reagieren? Welche Zukunft hat der Sozialstaat? Und wie werden sich durch die neue Arbeitswelt soziale Ungleichheiten womöglich verschärfen?Das alles sind drängende Fragen, auf die Geuss in seinem Essay leider keine befriedigenden Antworten gibt.
Statt sich mit der Arbeitswelt der Tech-Unternehmen wie Google oder Microsoft auseinanderzusetzen und auch mit den Herausforderungen durch KI, statt die Jobs in der Finanzindustrie, der Unterhaltungsindustrie oder im Dienstleistungssektor - zum Beispiel von Krankenpflegern, Amazon-Lageristen oder Paketboten - zu analysieren, entwickelt er eine umständliche Definition von Arbeit, die sich vor allem am Leitbild der körperlichen Arbeit, d.h. der alten, sattsam bekannten Industriearbeit orientiert.
Arbeit, in diesem Sinn, ist eine kontinuierliche Tätigkeit an einem bestimmten, vom Zuhause getrennten Ort - Geuss denkt vor allem an die Fabrik -, und sie hat eine soziale Struktur, da sie sich in Zusammenarbeit mit anderen unter den Bedingungen einer kapitalistischen Ökonomie vollzieht.
Homeoffice statt Fließband
Das ist keine große Einsicht. Vor allem bleibt unklar, warum Geuss auf dem Hintergrund seiner historischen Betrachtung nicht die naheliegende Frage stellt, was es für die von ihm zitierte „Klassenstruktur“ bedeutet, wenn die Arbeit vieler Angestellter heute durch das Homeoffice definiert wird und nicht mehr am Fließband oder Hochofen stattfindet, sondern am Computer.
Die solidarische Organisation der Arbeitenden, z.B. in Gewerkschaften oder Betriebsräten wird so erschwert, das Outsourcen von Arbeit erlaubt es, soziale Standards auszuhöhlen. Bei Geuss ist davon ebensowenig die Rede wie von der Kaste der Banker, die heute die Weltwirtschaft wesentlich prägen, wie wir durch diverse Bankenkrisen wissen. Finanzspekulanten, aber auch Unternehmensberater hält der Philosoph für moralisch verwerflich und daher keiner Analyse wert.
So geht er an der Realität der modernen Arbeitswelt großzügig vorbei. Die historischen Einsichten von Hegel und Marx über Entfremdung streift er nur und stellt sie sehr eigenwillig, wenn nicht falsch dar. Die Analysen zeitgenössischer Soziologen wie Jeremy Rifkin oder Richard Sennett, die über die Flexibilisierung der Arbeit und die Industrie 4.0 intensiv nachgedacht haben, kommen in seinem Essay nicht vor.
Stattdessen behandelt Geuss ausführlich die anthropologische Frage, ob Menschen von Natur aus faul seien, lässt aber die aktuelle Diskussion über ein garantiertes Grundeinkommen aus, die damit zusammenhängt.
Fatale Verkürzung auf Industriearbeit
Ohne Begründung wiederholt er die vielfach widerlegte, zumindest umstrittene These, fortschreitende Automatisierung führe zu wachsender Arbeitslosigkeit. Hier zeigt sich die Konsequenz von Geuss´ fataler Verkürzung des Arbeitsbegriffs auf die Industriearbeit. Die neuen Jobs in der Digital- und Dienstleistungsindustrie bekommt er nicht in den Blick.
So bleiben seine Überlegungen zur Arbeit ebenso altbacken wie analytisch nichtssagend. Der rote Faden einer seine Betrachtungen verbindenden These fehlt. Auf die Frage, wie eine unentfremdete bzw. humanere Arbeitswelt der Zukunft aussehen könnte, gibt er keine Antwort. Stattdessen kommt er zu der fast schon komisch anmutenden Prophezeiung, die meisten Menschen würden wohl „beim postindustriellen Äquivalent einer Sammler- und Jägerexistenz landen“ und in Zukunft nur noch Gelegenheitsarbeiten ausführen. Weltfremder kann ein Essay über die Arbeit nicht sein.
Gespräch Ständiger Zwang zur Selbstoptimierung? Juliane Marie Schreiber möchte lieber nicht
Gerade zum Jahresbeginn versucht man gerne, über gute Vorsätze das Beste aus sich rauszuholen. Für Juliane Marie Schreiber ist dieser ständige Zwang zur Selbstverbesserung ein „Terror des Positiven“. In ihrem Buch „Ich möchte lieber nicht“ fordert sie dazu auf, öfter auch mal Nein zu sagen.
Wort der Woche Bullshit Jobs
Ein Drittel unserer Jobs sind Bullshit, sagt der Wissenschaftler David Graeber von der London School of Economics. Und er meint damit Arbeiten, die keinen Sinn ergeben, die oft mit hoch trabenden Bezeichnungen wie "Human Ressources Management Consultant" daher kommen, aber für wenig oder keinen Inhalt stehen. "Bullshit Jobs" - für den Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen das "Wort der Woche", weil es einen bestimmten, durchaus fragwürdigen Zeitgeist widerspiegele.
Buchkritik David Graeber: Bullshit-Jobs
Welche Arbeit hat einen Wert für den Einzelnen und für die Gesellschaft? David Graeber, US-amerikanischer Ethnologe, Antikapitalist und Vordenker der Occupy-Bewegung, ist auch bekennender Anarchist. Was er über Jobs denkt, mag absehbar sein, ist aber trotzdem erkenntnisreich.