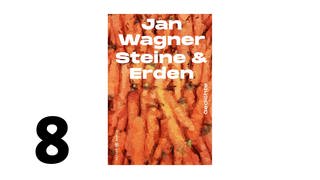Franz Josef Czernin ist ein Dichter, der mit Sprache experimentiert. Mehr noch: Er nimmt die Sprache beim Wort, und dabei gelingen ihm vielfältige Wortneuschöpfungen.
Nicht anders ist dies beim neuen Gedichtband „geliehene zungen“. Zunge auf lateinisch heißt „lingua“ - und meint auch Sprache. Dem Dichter ist die Sprache etwas Geliehenes, damit er Neues erschafft. Czernin löst diesen Anspruch ein. Mit Hintersinn, Witz und voll Poesie.
Wer mit „gespaltener Zunge“ spricht, ist einer, der heuchlerisch redet oder gar die Unwahrheit sagt. Aber was meint „geliehene zungen“ – so der Titel des neuen Gedichtbandes von Franz Josef Czernin? Da muss man zum lateinischen „lingua“ zurückgehen, was sowohl „Zunge“ als auch „Rede“ oder „Sprache“ bedeutet.
Doch für einen Dichter wie Czernin, der Poesie, Poetik und Essayistik meisterlich beherrscht, kann die deutsche Sprache nichts Geliehenes sein! Oder doch? Je mehr man sich einer poetischen Rede bedient, desto stärker wird einem bewusst, dass Sprache einem etwas leiht – um Neues zu kreieren. Das führt der Österreicher Czernin nun in neuen 66 Gedichten vor.
Horchideen, Sinnsoldaten und Lockomotiven
Zum Beispiel sind es Wortneubildungen, die man im Band „geliehene zungen“ mannigfach antrifft: Da finden sich „horchideen“, die mit Botanik so gar nichts gemein haben. Die „sinnsoldaten“ gehören sicher nicht in die Zinnfiguren-Industrie. Bei „schock- und lockmotive“ mag man an den Beginn der Eisenbahn denken, als Lokomotiven eine Menge Dampf spien und die Menschen schockten, aber auch – als Motiv – anlockten.
Den heutigen „eil- und eichenzügen“ begegnet man gelassen, wobei letztere eher in das Fach des Holzspielzeugs gehören. All diese Komposita haben etwas gemeinsam: den „wörterbruch“. Denn die aus der Sprache geliehenen Worte stehen als Neubildungen für etwas, das die Rede so nicht kennt. Man findet sie in keinem Lexikon.
Reine und unreine Reime zuhauf
„eben war das blatt noch plan und leer“. Das weiße, noch unbeschriftete Blatt füllt sich im Akt des Schreibens mit Wörtern, wird flächig. Das Gedicht selbst bringt die Zunge zum Sprechen. Und das Reimen ist der Zunge Freud. Bei Czernin wirbeln reine wie unreine und Binnen-Reime durch die Gedichte. In seinen Texten „wüten“ die „mythen“.
Wer hingegen die Natur lyrisch besingt allein durch „blätter“, wiegend sich in jedem „wetter“, schreibt bloß „die groteske letter“ – Der Dichter ist somit der „pittoreske Retter“. Pittoresk wäre es, wenn Czernin behaupten würde, dass Reimen per se Sinn stifte, dass Reimen - wie einst in Balladen – Teil einer lyrischen Erzählung sei.
So erzählen Czernins Gedichte keine Geschichte, aber es gibt Hinweise, worum es ihm geht. Ein Gedicht trägt den Titel „self portrait of an old artist“. Ironisch wird Bezug auf den Roman „A portrait of the artist as a young man“ von James Joyce genommen. Der Dichter ist alt geworden. Kein „dramadonner“ kann ihn noch aus der Ruhe bringen. Und „weltenretter“ ist er auch keiner mehr – falls er das je geglaubt haben sollte.
Und doch befindet sich der Dichter weiterhin auf der poetischen Bühne. Viele Worte im Gedichtband weisen darauf hin: „premiere“, „von der bühne“, „drama“, „oper“, „zirkus krone“. Und die „primadonna“ wird zum „prima donner“.
Miteinander sprechen, aber geistreich!
Es geht in Czernins neuem Gedichtband auch um gemeinsames Sprechen. Oftmals gehört die poetische Bühne dem Wir. Die Krux vieler langjähriger Beziehungen ist, dass der gemeinsame Zungenschlag erlahmt. Doch der Dichter gibt nicht auf. Man muss das sprachliche Miteinander stets aufs Neue versuchen – und dann wird es ein „freudeschrein“, wie Czernin schreibt.
Sinn, Widersinn und Unsinn des Lebens liegen eng beieinander, das weiß auch das dichtende Ich. Das lässt sich einerseits mit Ironie beschreiben:
viel erlitt hier der artist, / der überflieger, der zirkular sich funkt
Andererseits voll Melancholie:
bin einer letzten letter frosch, / prophezei mein licht, das längst erlosch
Dass das poetische Licht von Franz Josef Czernin noch lange nicht ausgebrannt ist, beweist der Band „geliehene zungen“. Sprachspielerisch, voll Erfindungsreichtum, reimfroh, hintersinnig wie witzig, melancholisch und stets poetisch geistreich – so soll, ja muss Dichtung auf der Höhe der Zeit sein!
Mehr Lyrik
Platz 8 (28 Punkte) Jan Wagner: Steine & Erden
Neue Gedichte des Büchnerpreisträgers: Man liest eine Zeile, findet Bilder – und die Erinnerung blitzt auf. Wagners durchrhythmisierte Zeilen wirken angetrieben von Spracherforschungslust, von Neugier auf das nächste Wort.
Gespräch und Lesung José F.A. Oliver – In jeden Fluss mündet ein Meer. Essays
„In jeden Fluss mündet ein Meer“ – so heißt der neue Essayband von José F.A. Oliver. Und das stimmt, wurde der Autor doch 1961 in Hausach an der Kinzig geboren, einem Fluss im Schwarzwald. Das Meer aber hatte seine Familie stets im Gepäck, denn die Eltern waren als Arbeitskräfte nach Deutschland gekommen. Sie kamen aus dem spanischen Málaga, also vom Mittelmeer.
In seinen neuen Essays erzählt José Oliver davon, wie sich für ihn das Andalusische mit dem Alemannischen verband, das Spanische mit dem Deutschen. Deshalb wollte er schon früh ein Heimatdichter werden – aber einer mit Reiselust. Zwar denkt er in einem seiner Texte auch an die Attentate von Solingen und Hanau, doch steht das Bereichernde eines Lebens in zwei (oder mehr) Kulturen im Zentrum seiner poetischen Prosa: „Ich war niemals Leidender, sondern ein Mehr- und más- und Meer-Kultureller.“
Im Gespräch mit SWR2-Literaturredakteurin Katharina Borchardt erzählt José F.A. Oliver von seinem weltläufigen Schreiben in Hausach und liest auch aus seinem neuen Buch.
Matthes & Seitz Verlag, 124 Seiten, 22 Euro
ISBN 978-3-7518-0950-4